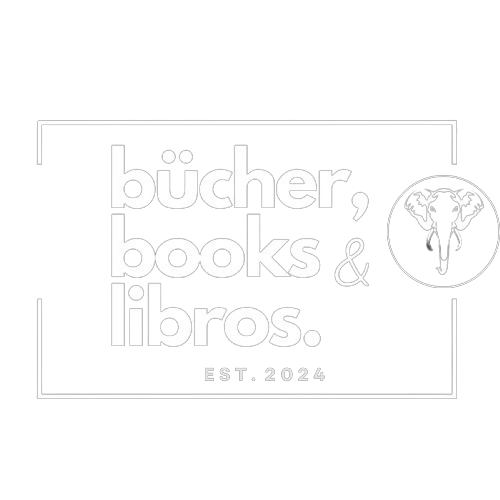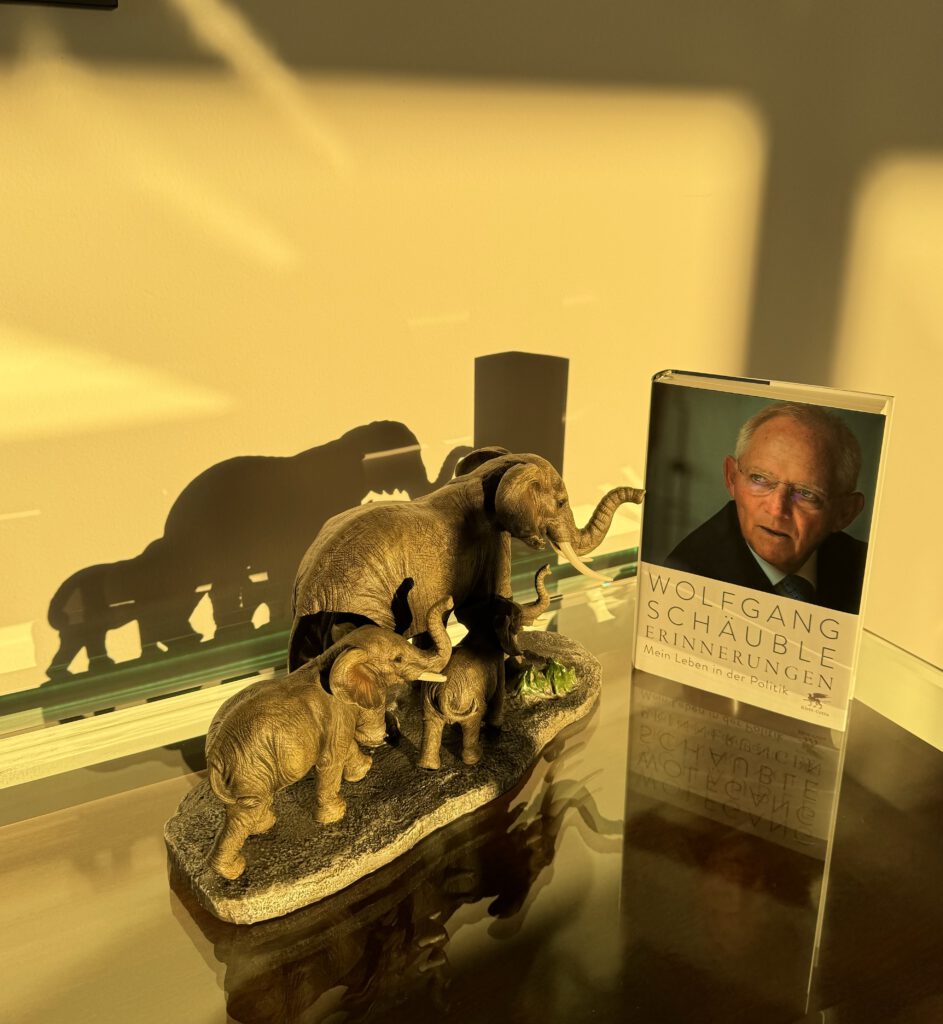
Die Aussagekraft und die Verfallszeit von Politiker-Büchern und Memoiren sind nicht selten begrenzt. Die „Erinnerungen“ von Wolfgang Schäuble, mit 51 Jahren Parlamentszugehörigkeit der Spitzenreiter in der Geschichte des Deutschen Bundestages, und, wenn ich es richtig sehe, der deutschen Parlamentsgeschichte insgesamt, fallen jedoch nicht unter dieses Verdikt.
Diese „Erinnerungen“ eines Politikers, der sich als „glücklichen Sisyphus“ verstand, sind ein lehrreicher, selbstkritischer, unterhaltsamer und intellektuell offener und anregender Gang durch fünfzig Jahre Politikgestaltung sowie deutscher und europäischer Geschichte.
Diese „Erinnerungen“ sind (hoffentlich!) ein Maßstab für all diejenigen, die künftig ihre „Erinnerungen“ mit der Öffentlichkeit teilen wollen.
Der für ihn wichtigste Ratschlag in seinem Leben stamme, so Schäuble, aus „Don Camillo und Peppone“. Der mit angeblichen Sorgen überladene italienische Dorfpfarrer Don Camillo beklagt sich vor Jesus am Kreuz und erhält die Antwort: „Nimm dich nicht so wichtig“. Im Übrigen auch der Leitspruch von Papst Johannes XXIII.
Nun kann man Wolfgang Schäuble schwer nachsagen, dass er sich seiner selbst und seines politischen Wertes nicht bewusst gewesen wäre. Dennoch war Bescheidenheit ein durchgängiger Zug in seinem Leben. Dies zeigt sich auch in seinen „Erinnerungen“.
Während man in vielen Autobiografien gerade von Politikern häufig von einer Hochglanz-Bilderflut überschwemmt wird, die den Autor beim Händeschütteln mit allen möglichen Stars, internationalen Berühmtheiten oder Staatsmännern zeigt, beschränkt sich Schäuble auf sehr wenige, dafür symbolträchtige und eindrückliche schwarz-weiß-Bilder.
Diese „Erinnerungen“ sind keine Selbstbeweihräucherung. Schäuble stellt im Nachhinein eigene Urteile wie Handlungen auch infrage. Er gibt zu, wenn er sich geirrt hat, Fehleinschätzungen unterlag oder sich um die eine oder andere Frage intensiver hätte kümmern müssen.
Er nennt sein Abstimmungsverfahren über den Grundlagenvertrag mit der DDR, seine nur bruchstückhafte Einschätzung der Bürgerrechtsbewegung in der DDR und hielt das Versprechen, die deutsche Einheit ohne Steuererhöhung zu finanzieren, für einen Fehler.
Er übergeht nicht seine unglückliche Rolle in der Parteispenden-Affäre, die ihn das Amt gekostet hat und von der er sagt, dass seine Familie bis heute davon überzeugt ist, dass diese Zeit „schlimmer war als die Monate nach dem Attentat“.
Schwer trägt er daran, nicht erkannt, beziehungsweise schlichtweg nicht für möglich gehalten zu haben, dass es in Deutschland zu einem NSU kommen könnte. „Ein schweres Versäumnis“ sieht er darin, „die Sorgen vieler Osteuropäer vor der Aggression Russlands zu lange nicht in angemessener Weise wahrgenommen haben“.
Diese selbstkritische Offenheit ist für Autobiografien von Politikern nicht unbedingt das Standardmaß.
Sobald ein derartiges Buch auf dem Markt kommt, geht im politischen Berlin die Suche im Personenregister los, ob man selbst auch erwähnt ist. Im Falle der Schäuble-Erinnerungen könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere ganz froh wäre, wenn er nicht genannt worden wäre.
In abgestuftem Ausmaß, aber doch sehr deutlich erkennbar wird, wen Schäuble geschätzt, vom wem er mehr erwartet und von wem er überhaupt nichts gehalten hat. Der Spitzenreiter in der letzten Kategorie dürfte sicherlich der wegen einer Plagiatsaffäre zurückgetretene ehemalige Wirtschafts- und Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg sein. Das Schäuble-Urteil: „Sein schnelles Verglühen im Zuge einer Plagiatsaffäre demonstriert, dass die Inszenierung als öffentliche Person an Grenzen stieß, wenn es an Substanz fehlte. Vom Star zur Sternschnuppe“.
Einen dramatischen und tiefgreifenden Einschnitt in sein Leben bedeutete das Attentat und dessen jahrzehntelangen Folgen für ihn. Hier erfährt man etwas detaillierter, ohne dass dies in Selbstmitleid oder Larmoyanz umschlägt, unter welchen psychischen und physischen Belastungen Schäuble über die Jahre seine Ämter bis an die Grenze des Erträglichen und darüber hinaus ausführte und dabei immer bemüht war, keine Schwäche zu zeigen – denn das wird im unbarmherzigen Politikalltag keinem verziehen.
Vielleicht ist auch so zu verstehen, dass über die bereits 2006 erhaltene Krebsdiagnose nur seine Familie und Merkel informiert waren.
Schäuble hatte ein klares Verhältnis zur Nation und freute sich darüber, dass
„heute ein unverkrampftes Verhältnis zur Fahne und unseren Staatssymbolen zum Glück weitgehend Normalität geworden“ ist. Da hätte Merkel noch was lernen können, die bei der Feier ihres Wahlsieges 2013 dem mit einem Deutschland-Fähnchen auf der Bühne des Adenauer Hauses wedelnden CDU-Generalsekretär Gröhe diese Fahne wegnahm.
Interessant und lesenswert sind auch seine wenngleich seltenen Vergleiche mit anderen Politikern. So kommt er mit Blick auf Oscar Lafontaine zu dem Schluss: „Was uns eint, war ein starker Gestaltungswille, womöglich auch ein gewisses strategisches Geschick. Aber vielleicht sind wir uns auch darin ähnlich gewesen, dass wir beide nicht mit letzter Unbedingtheit Kanzler werden wollten“.
Bei aller Kampfeslust und Zuspitzungsfähigkeit wird auch immer wieder das Bemühen erkennbar „ideologische Beißreflexe zu überwinden“. Schäuble setzte auf die Dialogbereitschaft und -fähigkeit. Selbst im letzten Urlaub auf Sylt nahm er sich Zeit für ein Gespräch mit dort demonstrierenden Punkern, die „Wolle“ dann mit Applaus verabschiedeten. Das schafft nicht jeder, dabei wäre es so nötig!
Schäuble verfügt auch über eine ausgeprägte Selbstironie, so wenn er beispielsweise angesichts der immer wieder aufbrechenden Debatte um seine Rolle als potentieller Nachfolger Kohls meinte, er habe „keine Lust, zum Prinz Charles der deutschen Politik zu werden“.
Wie überhaupt so manche Formulierung ebenso gelungen wie humorvoll sind, so wenn er Regieren als „ein Rendezvous mit der Realität« beschreibt oder sich über „die ewige deutsche Betroffenheitsschickeria“ mokiert.
Der für mich herrlichste Satz in dem gesamten Buch ist jedoch die Umschreibung seines Amtsverständnisses als Chef des Kanzleramts unter Helmut Kohl: „Zum anderen habe ich nicht nur reagiert, also darauf gewartet, wann er etwas von mir wollte, sondern bin selbst aktiv geworden, um Dinge anzustoßen. Der Grundsatz, der mich dabei leitete, lässt sich nicht auf eine scharfe Formel bringen. Ich habe es stets so erklärt: Ich orientiere mich daran, was der Kanzler wollen könnte, wenn er es richtig verstehen oder sich ausführlich damit beschäftigen würde. Das ist gar nicht despektierlich gemeint. Als Generalist musste er gar nicht jedes Detail kennen, und ich hätte auch nicht seine Zeit verschwenden wollen, um ihn mit jeder Kleinigkeit zu konfrontieren“.
Schäuble hat in seiner langen Karriere verschiedene Spitzenämter mit sehr unterschiedlichen Anforderungen nicht nur formal, sondern auch inhaltlich mit eigener Akzentsetzung ausgefüllt und auch gegen Widerstände immer wieder versucht, neue Wege zu gehen. So zum Beispiel mit der Islam-Konferenz. Er zitiert dabei Navid Kermani mit dem Satz, dass wer „die Feinde der offenen Gesellschaft bekämpft, indem er die eigene kulturelle Offenheit aufgibt, den Kampf bereits verloren (hat)“. Es gehe um „selbstbewusste Offenheit, nicht um Selbstaufgabe“.
Es ist wohl kaum etwas so bezeichnend für Schäuble und sein Politikverständnis wie die Beschreibungen des sich wandelnden Verhältnisses zu Helmut Kohl und Angela Merkel, das er in beiden Fällen sehr differenziert, aber auch sehr deutlich analysiert und beschreibt.
Über viele Jahre hinweg dominiert ein positives Bild von Kohl, geprägt von gegenseitigem Vertrauen und Loyalität. Differenziert, aber auch ohne jede Zurückhaltung zeichnet Schäuble die Entwicklung der letzten Kohl-Jahre nach. Die zunehmende Beratungsresistenz Kohls, sein „verinnerlichter Patriarchenstatus“, „immer mehr Hofstaatallüren“ bei sich gleichzeitig ausbreitender „Wagenburgmentalität“ – das passte nicht zu Schäuble. Im Kontext der Spendenaffäre kam es dann zum absoluten Bruch mit Kohl, in dessen letzten Lebensjahren die beiden kein Wort mehr miteinander gesprochen haben.
Auch sein Verhältnis zu Angela Merkel verstand Schäuble als von großer Loyalität geprägt, auch wenn er im Gegensatz zur Kohl-Ära nie zum inneren Zirkel Merkels gehörte.
An Angela Merkel hat er „immer hoch geschätzt, dass sie gesellschaftliche Veränderungen und Stimmungen, insbesondere im großstädtischen Milieu viel besser verstand als der Großteil der traditionellen CDU. Auch darin liegt eine ihrer großen Verdienste für die Partei, deren Vorsitzende immer in 18 Jahren lang war. Im späteren Verlauf überwogen aus meiner Sicht die Nachteile ihrer ständigen Suche nach Kompromissen mit Koalitionspartner und den anderen Parteien im Bundesrat“.
Er legt auch offen, dass „wir beide sehr unterschiedliche Ansichten davon haben, was es heißt, politisch zu führen“.
Schäuble ist „davon überzeugt, dass politische Führung auch über Inhalte, die gesellschaftlich kontrovers sind und der Bevölkerung etwas zumuten erfolgreich sein kann – wenn sie ihr Handeln plausibel erklärt“.
Hier setzt seine grundsätzliche Kritik an.
Er sieht Merkel sechzehn Jahre erfolgreich: „…mit dem weitgehenden Verzicht auf inhaltliche Auseinandersetzungen“. Schäuble verschweigt nicht seine überaus kritische Sicht auf das Konzept der asymmetrischen Mobilisierung im Wahlkampf, das heißt „die Vermeidung jeder Konfrontation, um die Wahlbeteiligung im Lager der Wettbewerber zu dämpfen und bei den eigenen Anhängern auf persönliche Beliebtheit zu setzen“. Er sieht darin eine „langfristig fatale Strategie“, die mit zum Anwachsen der AFD geführt habe.
Auch Merkels Zurückweichen vor mancherlei Erpressungen durch die CSU sieht er kritisch, da hätte er sich mehr Machtwillen und Konfrontationsbereitschaft gewünscht, es mal drauf ankommen lassen.
Jedenfalls war Schäuble froh, dass er in seinen letzten Parlamentsjahren „von Angela Merkels berüchtigtem Verhandlungsstil der Konsensbildung durch physische und psychische Ermüdung“ nicht mehr betroffen war.
Vor diesem Hintergrund sieht Schäuble den Unterschied zwischen den beiden langjährigen Kontrahenten Merkel und Merz darin, dass Merz „den Mut hat, nicht nur das Ende einer Diskussion abzuwarten, sondern sie selbst zu gestalten. Er würde damit zwar auch auf Widerstand stoßen, aber das würde der zu sehr auf Alternativlosigkeit getrennten politischen Debatte doch guttun und es dadurch erleichtern, wieder zu einer Integration der politischen Kräfte der Mitte zu kommen“.
Auch Merkel sei in mancherlei Hinsicht beratungsresistent gewesen und es habe „zunehmend an der Bereitschaft zur korrigierenden Selbstkritik“ gemangelt.
Vielleicht ist das eine zwangsläufige Konsequenz von zu vielen Jahren in solchen Machtpositionen.
Schäuble macht keinen Hehl daraus, dass „Merkels Führungsstil meine Loyalität strapaziert“ hat und bekennt, dass er in der letzten Zeit der Zusammenarbeit mit Merkel als Finanzminister aufgrund ihrer fehlenden Unterstützung in zentralen Fragen „mehrfach kurz davor stand hinzuwerfen und meinen Rücktritt zu erklären. Ich entschied mich bewusst dagegen, weil ich meine lange, politische Karriere auf ihrer Zielgerade nicht durch einen öffentlich ausgetragen Streit mit der Kanzlerin beschädigen wollte. Es widersprach meiner Pflichtauffassung“.
Seine und die lange Loyalität der Partei sieht er, und damit steht er nicht allein, von Merkel nicht immer erwidert: „Dass Angela Merkel nach ihrem Rückzug aus der Politik diese Verbundenheit mit ihrer Partei nicht aufzubringen vermag, sogar eher demonstrativ das Gegenteil vermittelt, irritiert mich auch deshalb dass sie derweil sogar treue, politische Gefährten meidet, tut fast schon weh““.
Sehr kritische Bemerkungen fallen auch über die Entwicklung von „Bankiers“ zu „Bankern“ und die unverhältnismäßigen Vergütungen und Boni für Industriebosse. Das führte dann zu der „gelegentlich geäußerten Bemerkung, man dürfe nicht zu lange Bundesfinanzminister sein, wenn man nicht als grundsätzlicher Kapitalismuskritiker enden wolle“. Noch deutlicher: „Anstand ist offenbar auch in diesen Kreisen zu einer knappen Ressource geworden“.
Was Schäuble bis zuletzt beschäftigt und umtreibt, ist die Reformschwerfälligkeit des politischen Systems und als Konsequenz dabei gefundene „Lösungen“. So kritisiert er Teile des bei der Bundestagswahl 2025 erstmals zur Anwendung kommenden neuen Wahlrechts bezüglich der Wahlkreiskandidaten als „ein System …, das auf Täuschung und Enttäuschung des Wählers ausgelegt ist. Ihm wird suggeriert, seine Wahlkreiskandidaten direkt wählen zu können – obwohl der Kandidat am Ende womöglich gar nicht ins Parlament gelangt“.
Diese Reformsklerose gilt auch für die EU im permanenten Spannungsverhältnis zwischen Erweiterung und Vertiefung. Schäuble wurde von einem nahezu euphorisierten zu einem nach wie nach wie vor überzeugten, aber ernüchterten Europäer.
In diesen Erinnerungen ebenso wie in einigen seiner vorangegangenen Bücher zeigt sich auch, dass Schäuble sicherlich zu den intellektuell interessantesten Politikern seiner Jahrzehnte zählte, der immer wieder Themen und Entwicklungen aufgriff, auch wenn er im funktionalen Amtssinne dafür gar nicht „zuständig“ war.
Eine seiner letzten Sorgen gilt der Künstlichen Intelligenz: „Eine Entwicklung, die mich durchaus fasziniert, deren Richtung und Folgewirkung aber weder ich verstehe noch offenbar die KI-Entwickler selbst richtig absehen können. Jedenfalls habe ich den Eindruck, dass wir bei aller aktuellen Krisenakkumulation deren teils dramatisch Appelle ernst nehmen sollten, um nicht sehenden Auges in die nächste Krise zu stolpern“.
Auf die Frage, „warum mir Politik auch nach fünf Jahrzehnten im Parlament noch immer Freude macht“ gab Schäuble die Antwort: „Als Erklärung für mich habe ich dazu einmal von Camus das Bild des glücklichen Sisyphos entliehen“.
Diese „Erinnerungen“ sind ein lehrreicher, selbstkritischer, unterhaltsamer und intellektuell offener und anregender Gang durch fünfzig Jahre Politikgestaltung sowie deutscher und europäischer Geschichte.
Diese „Erinnerungen“ sind (hoffentlich!) ein Maßstab für all diejenigen, die künftig ihre „Erinnerungen“ mit der Öffentlichkeit teilen wollen.
Wolfgang Schäuble hatte bis zuletzt an seinen „Erinnerungen“ gearbeitet. Vorstellen konnte er das im April 2024 erschienene Buch nicht mehr. Wolfgang Schäuble starb am 26. Dezember 2023.
#schäubleerinnerungen
#cdu
#deutschegeschichte
#klettverlag
#hilmarsack
#jenshacke