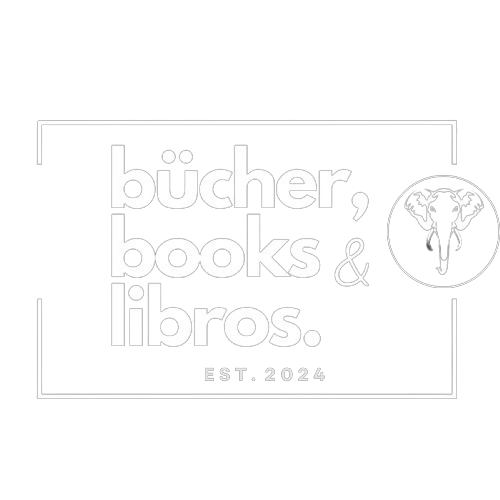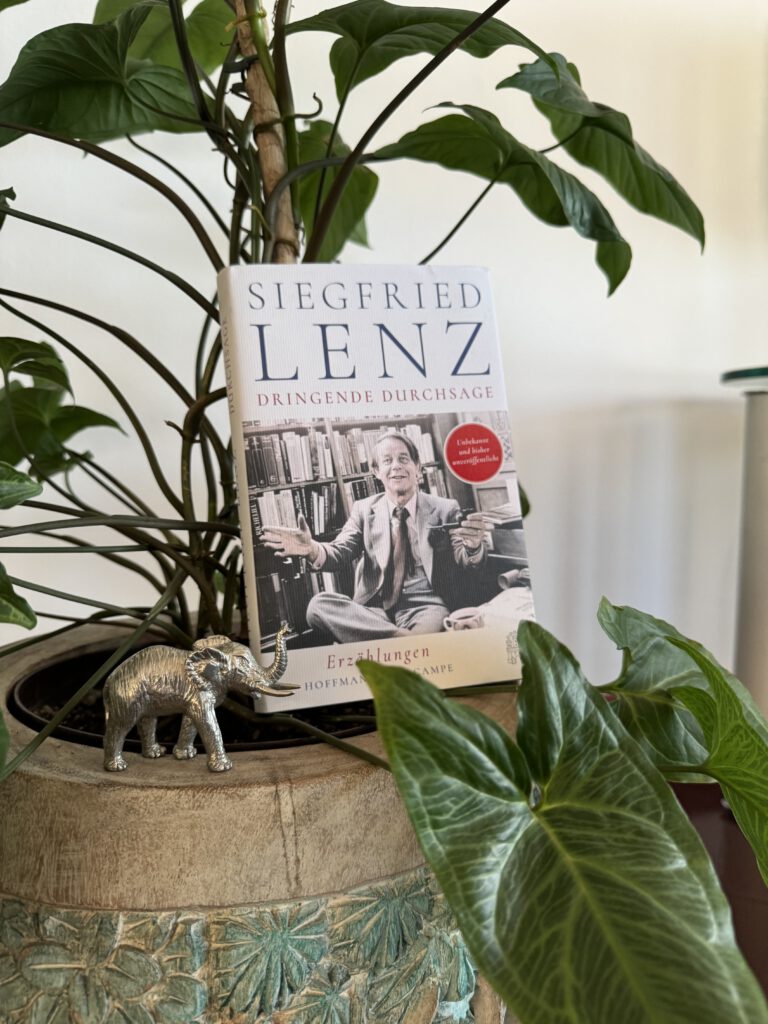
Ein „leer gedachter Mann“ analysiert die Traumvisionen seiner außerhalb ihrer „senkrechten Alltäglichkeit“ befindlichen Frau – und scheitert grandios. Siegfried Lenz in seinen Anfängen entdecken – es lohnt sich!
Siegfried Lenz zählt zu meinen bevorzugten Schriftstellern der deutschen Nachkriegsliteratur.
Zehn Jahre nach seinem Tod sind nun insgesamt 23 bisher ungedruckte Erzählungen aufgetaucht und zusammen mit elf weiteren, die zwar in Zeitungen erschienen, nicht jedoch in seinem Gesamtwerk enthalten sind, in diesem neuen Lenz-Band veröffentlicht.
Entstanden sind diese zwischen einer und fünfzehn Seiten umfassenden Erzählungen überwiegend in den Jahren 1948-1957.Die nicht immer exakt zu datierenden Erzählungen sind auch deshalb nicht chronologisch geordnet, sondern in sechs thematischen Kapiteln zusammengefasst.
Eine der besten Erzählungen ist für mich „Bei Godickes und Gieses, Adamikstrasse 15“, die thematisch den unmittelbaren Nachkriegserzählungen zugeordnet ist.
Die Bewohner eines bis auf die Hauswände zerbombten Hauses finden im Keller Unterschlupf, schöpfen aber selbst daraus Kraft: „War nicht einst alles aus den Katakomben ans Licht gebrochen, gestärkt und vorbereitet in sinnender Dunkelheit? Hat nicht der wunderbarste Aufruhr seinen Anfang in Höhlen genommen? Das Große reift in der Dämmerung“.
Lenz gelingt in der Folge eine faszinierende Beschreibung der auf den „Nullpunkt gefallenen Geschichte“, in ihrer zunächst ausweglos erscheinenden Sinnlosigkeit und Leere, aber auch mit der Chance des „makellosen Augenblicks eines neuen Beginns“.
„Das waren die Tage und Nächte dämmernder Geschichtslosigkeit, die Zeit stumpfen Neo – Fellachentums – das Bewusstsein war enteignet, die Erinnerung, die Gegenwart. Das Alte war vergessen; das Neue, das hereinbrechen sollte, unbekannt. Es war die sinnbildhafte Situation der Krise: der Mensch lebt ohne Entscheidungen, weil ihm die Möglichkeiten zu Entscheidungen fehlen. Zwischen jedem Schock und jähem Vergessen bleibt nur die Wahrnehmung einer einzigartigen Leere“.
Lenz schildert danach in sehr wenigen Sätzen wie „der neue Bogen mit der Weisheit der Narben gespannt“ wurde und sich das entwickelnde Wirtschaftswunder niederschlug, nicht zuletzt in einer „1952 registrierten durchschnittlichen Gewichtszunahme des westdeutschen Bürgers um acht Pfund“ und zunehmenden Auslandsreisen. Er erweist sich aber nicht nur als ironischer, sondern auch als äußerst kritischer Beobachter, wenn er etwa den „cultural lag“ anprangert: “Wir führen eine ausgewachsene Gespaltenheit spazieren: eine Seite von uns, die Seite des Zivilisationsgenüsslers, ist weit vorn, die geistige, sie lahmt, sie ist hoffnungslos zurückgeblieben“.
Die Frage nach Schuld und Verantwortung beziehungsweise die nach Kriegsende sehr schnell aufkommende Versuchung, sich von beiden reinzuwaschen und ihnen zu entgehen findet sich thematisch in einigen dieser Erzählungen wieder. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit kommt kaum voran, alte Netzwerke bestehen weiter und versuchen Einfluss zu nehmen. Dies ist Thema auch der titelgebenden Erzählung „Dringende Durchsage“.
Und schließlich die Macht der Gewöhnung: Zerbricht Godicke unmittelbar nach Kriegsende erbittert das Holzschwert, mit dem sein kleiner Sohn auf den Trümmern des Hauses spielt, so darf dieser wenige Jahre später mit einem von den Nachbarn geschenkten Spielzeugpanzer im Wohnzimmer um sich schießen.
Auch die Gewöhnung an den neuen Wohlstand thematisiert Lenz, vor allem in „Das Wochenende des Herrn Schmelz -Bundesrepublikanisches Alltagsleben“, der Schilderung der
Situation eines arbeitssamen, erfolgreichen Fabrikanten, dessen Familie im Gegensatz zu ihm das Leben in vollen Zügen zu genießen weiß.
In einer ganzen Reihe von Geschichten blitzt der hintersinnige Humor von Siegfried Lenz auf, der mir schon immer gefallen hat. Herrlich „Wovon man in Chlopitzken träumt…“, auf die Idee muss man erst mal kommen…mehr wird nicht verraten.
Eine zärtliche, selbstironische Liebeserklärung an seine Frau sind die „Signale aus dem Traum“.
Ein „leer gedachter Mann“ findet seine Frau nicht mehr in ihrer „senkrechten Alltäglichkeit“, sondern schlafend, als „Fohlen am losen Halfter des Traumes“. Als „erfahrener Ehe-Rekrut“ meint er, die Zeichen ihres Traumes lesen zu können, die ihn dann im Laufe der Nacht dazu bringen, seine Nachlässigkeiten des Tages rechtzeitig vor ihrem Erwachen auszubügeln. Nur um am nächsten Morgen festzustellen, dass er alles andere als ein Experte in der Interpretation von Traumsignalen ist.
In einem eigenen Kapitel widmet sich Lenz Tieren, behandelt sie wie gleichwertige Geschöpfe, siezt sie und lässt auch hier seinen Humor sprechen.
Erzählungen sehr unterschiedlichen Umfangs und Inhalts wechseln einander ab. Man kann nachverfolgen, wie Lenz verschiedene Schreibstile ausprobiert.
Auf knapp eineinhalb Seiten („Der einfache Weg“) bringt Lenz die Erfahrung eines nach jahrzehntelanger Haft Entlassenen auf den Punkt.
Das letzte Kapitel „Für andere hoffen – Geschenkte Erzählungen“ enthält gewidmete Erzählungen. So eine zum 70. Geburtstag des vormaligen Bundeskanzlers, Helmut Schmidt, ein enger Freund von Lenz. In diesem Beitrag thematisiert Lenz das Verhältnis zwischen Radikalität und Radikalismus, aber nicht, wie von den Herausgebern der Geburtstagsschrift gewünscht mit Blick auf den RAF-Terrorismus, sondern die Umweltproblematik. Auch insofern immer für Überraschungen gut.
Lenz hatte seinen eigenen Tonfall entwickelt in seiner Beobachtung und Beschreibung von Menschen, Situationen und Entwicklungen, der für mich sein Werk so besonders, ja geradezu sympathisch macht. Er war meinungsstark, bevorzugte aber dennoch die leisen, stillen (Zwischen)töne in seinem Leben und in seinem Schreiben, geprägt durch eine genaue Beobachtungsgabe und viel Sympathie für die Menschen.
Das Scharkantige, Polarisierende und Poltern überließ er anderen, von denen so mancher damit wohl auch gegen das eigene Gedächtnis anschrieb.
In Lenz´ Romanen standen selten die großen, fehlerfreien, von keinem Selbstzweifel angehauchten Helden im Mittelpunkt, sondern vielfach die kleinen, auch die scheiternden Helden in den Mühen des Alltags.
In einigen dieser Erzählungen schält sich so langsam dieser künftige Blickwinkel heraus. Ein besonders gutes Beispiel hierfür ist dabei auch „Die Abschiedsrede“ in der entgegen aller landläufigen Erwartung weder geschönt noch gelogen, sondern selbstdemaskierend die Wahrheit gesagt wird.
Und es sind immer wieder kleine Formulierungen, wie die “nachzitternde Erbitterung“ des von Reich-Ranicki kritisierten Schriftstellers, die begeistern.
In einem kurzen Nachwort werden die Zusammenstellung und Herkunft einiger Erzählungen erläutert. Maren Ermisch zitiert dabei auch das Bonmot von Marcel Reich-Ranicki, seit seiner Übersiedlung von Polen nach Deutschland sehr eng mit Lenz befreundet, der über Lenz gesagt hatte, „Lenz sei ein geborener Sprinter, der sich in den Kopf gesetzt habe, er müsse sich auch als Langstreckenläufer bewähren“.
Ich lese normalerweise lieber Romane als Erzählungen oder Kurzgeschichten. Bei Siegfried Lenz, den ich gerade als „Langstreckenläufer“ schätze, habe ich aber, ohne zu zögern, davon – mal wieder – eine Ausnahme gemacht und es nicht bereut. Reich-Ranicki hatte mal wieder Recht.
Auch wenn mich nicht alle Geschichten überzeugen konnten war es ein Genuss, Unbekanntes von Siegfried Lenz lesen zu können.
Wer, sollte das überhaupt möglich sein, Lenz noch nicht kennt, hat mit „Dringende Durchsage“ einen idealen Einstieg.
Siegfried Lenz: Dringende Durchsage
Verlag Hoffmann und Kampe, Hamburg 2024
ISBN: 978 – 3– 455 – 01823