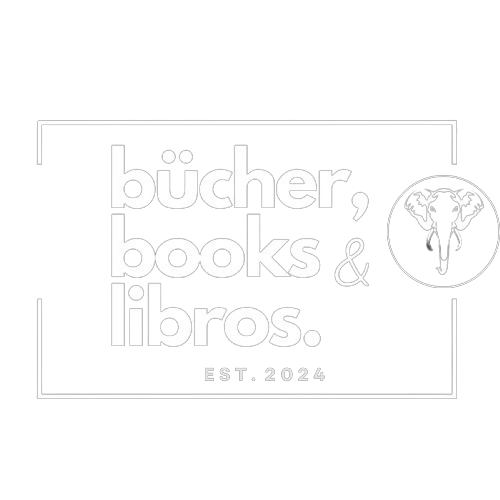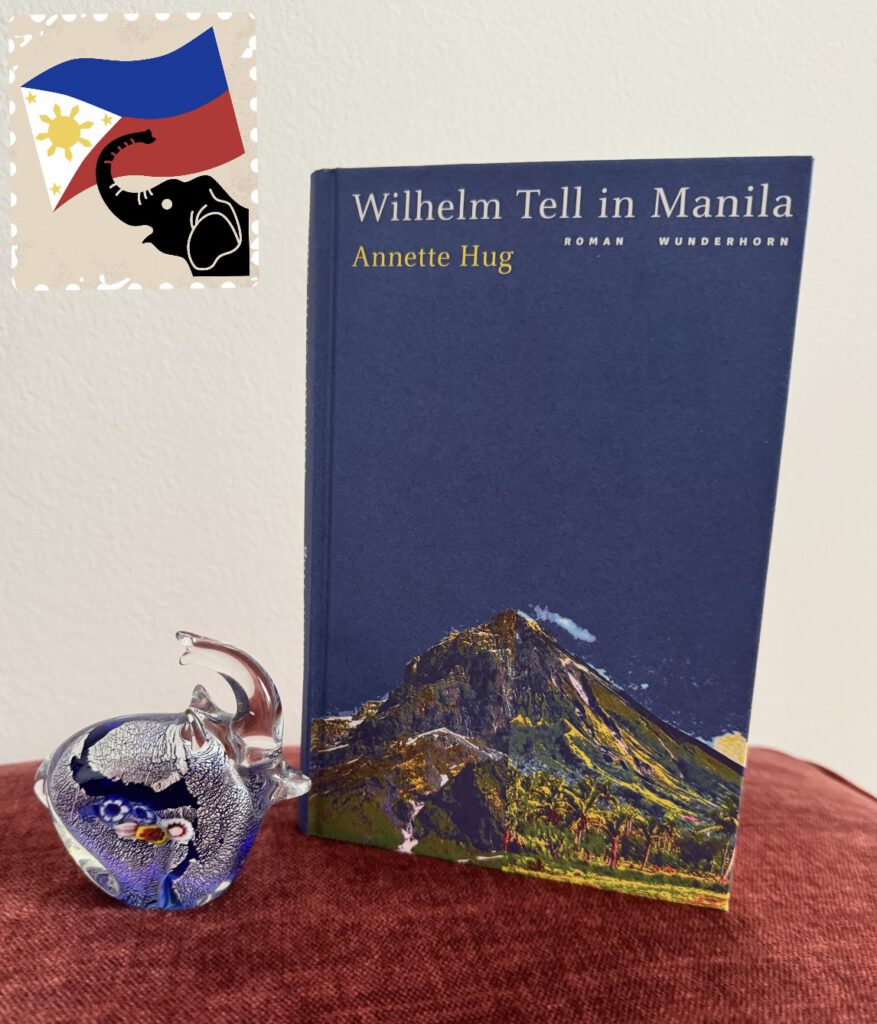
Der Titel macht stutzig: „Tell in Manila“? Was macht der Nationalheld aus den Schweizer Bergen in den tropischen Gefilden der rund 10 500 km entfernten Philippinen? Unterschiedlichere Lebenswelten vermag man sich gar nicht vorzustellen.
Annette Hug bringt diese beiden, und noch viel mehr, gekonnt zusammen. Von den 15 Büchern, die ich in diesen Wochen zu den Philippinen als Gastland bei der Frankfurter Buchmesse bespreche, ist „Tell in Manila“ das einzige, das nicht von einer philippinischen Autorin stammt.
Wer die Philippinen in den Blick nimmt, stößt ganz schnell auf José Rizal, den philippinischen Nationalhelden mit deutscher Vergangenheit.
Rizal verbringt 1886 in Heidelberg und Sachsen einige Monate, praktiziert bei einem Augenarzt, taucht in die Studentenwelt einschließlich der schlagenden Burschenschaften und deren medizinischer Versorgung ein. Vor allem aber schreibt er an seinem in Madrid begonnenen Buch weiter, das er in einem Pfarrhaus im einigen Kilometer von Heidelberg entfernten Wilhelmsfeld beendet und das als „Noli me tangere“ („Rühre mich nicht an“) 1887 in Berlin in spanischer Sprache gedruckt wird.
Rizal lernt deutsch, sein Bruder schreibt aus den Philippinen: „Übersetz uns Schiller“.
Hug nimmt uns mit auf Rizals monatelange Reise durch Deutschland, im Mittelpunkt steht dabei neben dem Abschluss seines eigenen Roman sein Ringen um die Übersetzung von „Wilhelm Tell“.
Hug verschränkt in einem Zeitwirbel die Ereignisse in den Philippinen, den Aufstand der Schweizer gegen Gessler und die Studentenunruhen in Madrid in den achtziger Jahren des 19. Jahrhundert.
Das einigende Band all dieser Geschehnisse ist der Freiheitsdrang der Völker, gleichgültig, auf welchen Breitengraden sie leben. „Alle freien Menschen sind ein einzig‘ Volk“, dieser Teil des Rütli-Schwurs aus Wilhelm Tell findet auch auf den Philippinen seinen Widerhall. Verschachtelte Parallelen zwischen der Situationsanalyse und dem Entstehen und Organisieren des Widerstandes in der Schweiz und in den Philippinen führt zu den ewigen Fragen solcher vorrevolutionärer Situationen. Auf der einen Seite die Herausforderung, für die Freiheit zu kämpfen, „während den Alten im Tal ihre Steinhäuser wichtiger sind.“ Auf der anderen Seite das permanente Abwägen, bis wann man abwarten sollte, ab wann gehandelt werden müsste.
Die Kritik an den herrschenden Machtverhältnissen und der Unfreiheit für die Untertanen ist der rote Faden. Sind es in Schweiz die weltlichen Herrscher, richtet sich Rizals massive Kritik in „Noli me tangiere“ vor allem an die katholische Kirche und verschiedene Mönchsorden im Besonderen. Dennoch differenziert Rizal bei aller Kritik: So er lehnt zwar den philippinischen Wunderglauben mit Blick auf an die Küsten gespülte Heiligenstatuen ab, „aber er teilt den Schluss, den das Volk aus der Legende zieht: Man darf die christliche Religion nicht auf die unwürdigen Instrumente ihrer Verbreitung reduzieren“.
Eine weitere besondere Verbindung dieser beiden Parallelerzählungen gelingt durch die Herausforderung, Schiller in Tagalog zu übertragen. Tagalog, die Sprache der größten Ethnie der Philippinen, bildet die Grundlage für das „Filipino“, die offizielle Sprache der Philippinen neben dem Englischen und bedeutet „Herkunft vom Fluß“.
Keine einfache Aufgabe, eine Reihe spezieller Termini aus Wilhelm Tell dem heimischen Publikum näher zu bringen. Wie übersetzt man „Landvogt“, „Reichsunmittelbarkeit“ oder „Anmut“? „Lawinen“ und „Gletscher“ zählen auch nicht zum angestammten Sprachgebrauch der Filipinos. Eine direkte Übersetzung ist vielfach unmöglich, Rizal will aber zumindest „die Idee durch die Zeilen schimmern lassen“.
Natürlich kann der deutsche Leser die Wahl des Tagalog-Wortes nicht beurteilen, er wird jedoch mittelbar an diese exotische Sprache und ihren vor allem in den 17 verschiedenen Konjugationsformen der Verben zum Ausdruck kommenden Reichtum herangeführt. Ein besonderer Reichtum, da ihn „die Mönche nicht stehlen (können), denn da, wo es drauf ankommt, hören sie nur leeres Silbengeklingel“.
Rizal entdeckt den Reichtum seiner Sprache und wird sich ihres revolutionären Potenzials bewusst.
Er muss so schreiben, dass der Bauer ihn versteht. Denn: „Und sei eine Rasse auch in Trägheit und Schwäche versunken, so werde sie sich immer an ihrer Sprache selbst aus diesem Zustand hervor arbeiten können“.
Die Schweiz und Wilhelm Tell sind das Vorbild: „Wenn nun Schiller meint, die Freiheit könne aus dem Haupt eines Bauernjungen im hintersten Gebirge wachsen, dann wird alles möglich. Dann sind die Wege, Kanäle, die Übertragungen und Entladungen der Universalgeschichte so verworren und unvorhersehbar wie die unterirdischen Schluchten, auch die besten Seismographen wissen nicht mit Sicherheit, wo und wann die Erde das nächste Mal beben wird. Und niemand kann voraussagen, wo sich nächstens ein Volk erhebt.“
Ähnlich wie dem alten Attinghausen aus „Wilhelm Tell“ ist es auch Rizal „unerträglich, sich vorzustellen, dass sich niemals etwas ändern würde“. Rizal schreibt an den österreichischen Philippinen-Experten Blumentritt: „Wer aus den Kolonien kommt, ist dazu, verdammt, sein Leben der Politik zu widmen“. Rizal wird kein Politiker, greift aber mit seiner Feder in die historische Debatte ein.
Wie er im Nachwort zur Urausgabe von „Noli me tangere“ 1887 ausführte, werde er, um das Krebsgeschwür seines Vaterlandes zu kurieren, „mit dir verfahren, wie es die Alten mit ihren Kranken taten. Sie stellten sie auf den Stufen des Tempels zur Schau, damit jeder, der kam, die Gottheit anzurufen, ihnen ein Heilmittel vorschlüge. Zu diesem Zweck werde ich versuchen, deinen Zustand getreulich und schonungslos zu beschreiben. Ich werde einen Zipfel des Schleiers lüften, der das Übel bedeckt, und alles der Wahrheit opfern…“
Rizal sorgte bereits vor seinem Deutschlandaufenthalt mit einer Rede weniger in Madrid als in Manila für Aufruhr, diese wird als Ausdruck eines hochverräterischen Unabhängigkeitsstrebens interpretiert. Man warnt ihn vergeblich vor einer Rückkehr auf die Philippinen.
Rizal wollte zwar mit der Katipunan, einem nationalistischen Bund, der ab 1892 gegen die spanische Kolonialherrschaft kämpfte, nichts zu tun haben: „Seine Hoffnung ruhte auf der Wissenschaft, der Volksbildung und hygienischen Verbesserungen. Aber es wurde behauptet, er sei mit dabei. Sein Name hatte sich selbstständig gemacht, er sei ein Wunderdoktor hieß es. Einen Agenten des deutschen Imperialismus nannte man ihn, einen Propheten des alten oder des neuen Lichts, einen Salon, Revoluzzer, Frauenheld, den ersten Romancier, einen Landesvater.“
Rizal wurde am 30. Dezember 1896 in Manila hingerichtet, der Rizal-Park an der Manila Bay erinnert daran.
„Tell in Manila“ verbindet in nahezu poetischer Weise Geschichte mit Geschichten, Realität mit Fiktion.
Ein interessantes Buch, das man zusammen mit Rizals „Noli me tangere“, aber auch dessen Folgeroman, „El Filibusterismo“(„Die Rebellion“), lesen sollte.
„Noli me tangere“ werde ich in den nächsten Wochen hier vorstellen.
Anette Hug, Tell in Manila, Das Wunderhorn
José Rizal, Noli me tangere., Suhrkamp
José Rizal, Die Rebellion, Morio Verlag