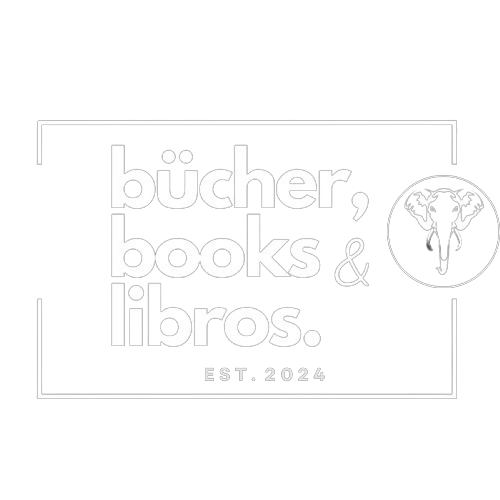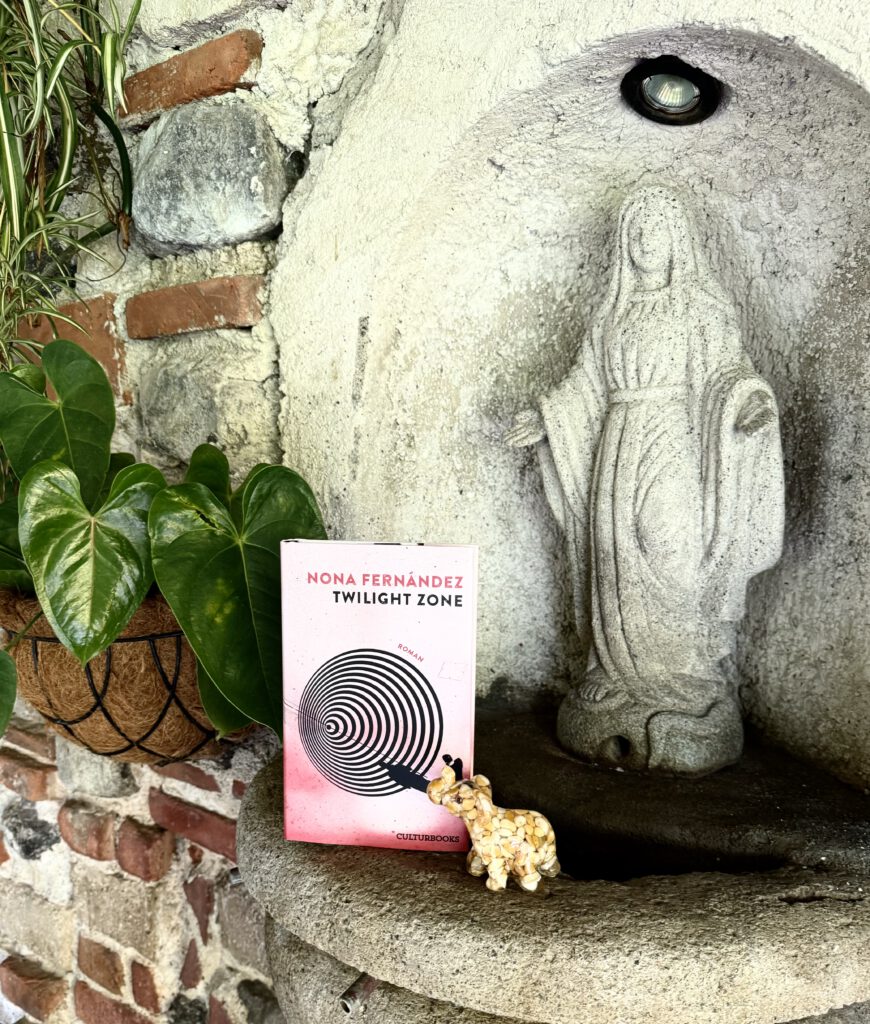
Lateinamerika hat im Laufe seiner Geschichte viele blutige und traumatische Erfahrungen mit Diktaturen sehr unterschiedlicher politischer Couleur gemacht.
Die Pinochet-Diktatur in Chile zwischen 1973 und 1990 ist nur eines von vielen Beispielen. Die chilenische Schriftstellerin Nona Fernández widmet sich in ihrem Buch in Anlehnung an die US-amerikanische TV-Serie „Twilight Zone“ dieser brutalen Phase der Geschichte ihres Heimatlandes.
Diktaturen mögen zu Ende gehen, sie mögen in aktuellen Debatten verblassen, an Gegenwärtigkeit und an tagespolitischer Bedeutung verlieren. Ihre Auswirkungen sind jedoch auch Jahrzehnte nach ihrer Überwindung existent und spürbar. Erinnerung, Aufarbeitung, Fruchtbarmachung der historischen Erfahrungen sind andauernde Herausforderungen der Gesellschaft, die sich gerade auch in der jeweiligen Literatur, vielfach auch erst Jahrzehnte nach Überwindung der Diktatur, widerspiegeln.
Nona Fernández kombiniert in ihrem Roman Autobiographie, Fakten und Fiktion. Zu den Fakten zählt, dass 1984, noch ist ein Ende der Pinochet-Diktatur in Chile nicht abzusehen, ein Mann das Büro einer kleinen oppositionellen Zeitschrift in Santiago de Chile betritt, sich als Mitarbeiter des Geheimdienstes zu erkennen gibt und gesteht, gefoltert zu haben. Auch wenn Name und Ausweisnummer dieses Mannes bekannt sind, anonymisiert ihn Fernández im weiteren Verlauf der Geschichte und nennt ihn in ständiger Wiederholung nur noch „der Mann, der gefoltert hat“.
Als kleines Mädchen hat sie sein Bild in der Zeitung gesehen. Sie erinnert sich daran, als sie 25 Jahre später als Investigativ-Journalistin an einer Geschichte über diesen Mann und die Aufdeckung der Verbrechen arbeitet. Tatsachen und Imagination vermischen sich.
Das Buch gewinnt sein Spannungsmoment nicht zuletzt aus dem Kontrast zwischen der Anklage wegen der Verbrechen des Regimes und der durchgängigen Ambivalenz in der Beurteilung des Mannes, der gefoltert hat.
Die Erzählerin klagt an, das Regime, aber auch einzelne Personen, sie arbeitet auf, sie erinnert. Für sie ist klar, dass „das Böse sich direkt proportional zur Dummheit (verhält)“: „Es stimmt nicht, dass die Kriminellen brillant sind. Man braucht eine ziemliche Portion Dummheit, um die Teile einer solch grotesken, absurden und grausamen Maschinerie zu steuern. Bloße Bestialität, getarnt als Masterplan. Kleine Leute mit kleinen Köpfen, die die Abgründe der anderen nicht verstehen. Dafür besitzen sie weder Sprache noch Werkzeug. Empathie und Mitgefühl sind Eigenschaften eines hellen Verstandes. Die Möglichkeit, ein Stück in den Schuhen der anderen zu gehen, die Haut zu wechseln und sich ein anderes Gesicht aufzusetzen: das ist eine Übung der reinen Intelligenz“.
In einer Mischung aus Fakten und imaginierter Ergänzung schildert die Erzählerin Einzelschicksale von Menschen, herausgerissen aus ihrem Alltag, ihrer Lebenswirklichkeit, bevor jeder Einzelne in der anderen, der „Unbekannten Dimension“, so der spanische Originaltitel, verschwindet.
Sie tut sich aber erkennbar schwer, den Mann, der gefoltert hat, in diesen Komplex wertend einzuordnen.
Immer wieder werden imaginierte Gespräche mit dem Mann, der gefoltert hat, oder dessen ebenfalls imaginierte Lebenssituationen eingeschoben. So malt sie sich dessen Flucht aus Chile über Argentinien nach Europa aus und erreicht es, dass man unwillkürlich mit ihm bangt, ob er es unbehelligt über die Grenze schafft. Oder sie stellt sich sein Leben im Exil vor.
Bei einem Besuch des 2010 eröffneten “Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos de Chile” (Museum der Erinnerung und der Menschenrechte“) sucht sie diesen Mann auf Bildern und in Dokumenten, weiß aber, dass sie ihn dort nicht finden wird: „Er gehört nicht zum Guten oder zum Bösen, zu Weiß oder Schwarz. Der Mann, den ich mir vorstelle, bewohnt eine ungenaue Gegend, unbequemer und schwieriger einzuordnen, und vielleicht hat er darum keinen Ort unter diesem Dach“.
Sie formuliert die Frage, die sich jeder Nachgeborene stellen sollte: „Wie entscheidet man, dass man etwas nicht mehr kann? Wo ist die Grenze, diese Entscheidung zu treffen? Gibt es eine solche Grenzen? Was hätte ich getan, wenn ich wie Sie mit achtzehn Jahren zum Wehrdienst angetreten wäre und mein Vorgesetzter mich auf eine Gruppe politischer Gefangener hätte aufpassen lassen? Hätte ich den Befehl befolgt? Wäre ich weggelaufen? Hätte ich begriffen, dass das der Anfang vom Ende ist“?
Für die Erzählerin stellt sich die Frage: „Wie viele Gesichter kann ein Mensch haben“?
Die Bewertung des Verhaltens des Mannes, der gefoltert hat, bleibt bis zum Schluss ambivalent, offen. Während die Ich – Erzählerin ihrem Lebensgefährten M. gegenüber insistiert, dass der Mann, der gefoltert hat, das Monster, seine Taten bereut hat, besteht M. darauf: „Das kann schon sein. Aber das macht es nur zu einem reumütigen Monster“.
Dieses Buch ruft mehr als nur eine Phase chilenischer Geschichte in Erinnerung. Die Zahl der Ermordeten während der Pinochet-Diktatur wird auf rund 3000 geschätzt. Mehrere zehntausend Verhaftete und Gefolterte sowie mehrere tausend Verschwundene, offiziell sind bis heute noch immer Schicksal und Verbleib von 1460 Menschen nicht aufgeklärt, gehen auf das Konto Pinochets und seiner Schlächter.
So erschreckend diese Zahlen in der Statistik auch sind, sie bleiben abstrakt, angesichts der Verbrechensdimension schwer nachvollziehbar. Mit Blick auf die Fotos der Ermordeten und Verschwundenen ist für die Erzählerin „jedes dieser Fotos…eine Postkarte aus der Vergangenheit. Ein Hilferuf, der laut schreiend darum fleht, gehört zu werden“. Nona Fernández durchbricht diese Abstraktheit der Zahlen, sie gibt den Abstraktionen Namen, sie verleiht ihnen eine Stimme, erzählt ihre Geschichte und ermöglicht so zumindest ansatzweise Nachvollziehbarkeit, Annäherung, ja Mitleiden.
Ein Thema klammert Fernández aber unausgesprochen aus. Es geht ihr nicht um die Frage des Verzeihens, was wohl auch eine sehr persönliche Entscheidung der Betroffenen und ihrer Familien ist. Ihr geht es um Erinnern, um Nicht-Vergessen, “der Welt, die schlechte Nachricht zu überbringen, wozu wir fähig waren”.
Mit „Twilight Zone“ gelingt ihr dies auf beeindruckende Weise. Es ist ein sehr intensives, eindringliches Buch, das nachwirkt.
Hierzu trägt auch die formale Gestaltung bei. Erzählung, Fakten und Imagination wechseln einander ab, ergänzt durch monologartige Einschübe der Erzählerin oder des Mannes, der gefoltert hat. Das Buch endet mit einer Art Gedicht, nach dem Vorbild des Liedes „We didn`t start the fire“ von Billy Joel, in dem er alle wesentlichen Ereignisse und Personen zwischen 1949 und 1989 aneinanderreiht. Die Erzählerin verwebt in ihrem Gedicht alle persönlichen und politischen Ereignisse beginnend mit dem Putsch Pinochets 1973 bis zu seiner Beerdigung 2006.
Zu den unerträglichen Ungerechtigkeiten in der Geschichte zählt, dass ein Verbrecher wie Pinochet nie für seine Taten zur Verantwortung gezogen wurde. Zwar wurde er aufgrund eines Haftbefehls des spanischen Richters Garzón in England unter Hausarrest gestellt, nach eineinhalb Jahren wegen gesundheitlicher Probleme jedoch entlassen und nach Chile ausgeflogen, wo er putzmunter die Gangway herunterlief, aufgrund eines Sondergesetzes Straffreiheit genoss und Ende 2006 in Freiheit starb.
Denkt man an Literatur aus Chile, so wird Vieles überlagert vom Welterfolg Isabel Allendes (ihr Vater war ein Cousin von Salvador Allende), deren erstes Buch „Das Geisterhaus“ bis heute für mich noch immer ihr bestes ist.
Dennoch: Die chilenische Literatur hat mehr zu bieten. Es lohnt sich, Nona Fernández, von der einige Titel in Deutsch vorliegen, zu entdecken.
Deutsche Ausgabe:
Nona Fernández: Twilight Zone
Culturebooks 2024
ISBN:9788-3-95988-193-7
Spanische Ausgabe:
La dimensión desconocida
Random House
ISBN: 978-8439732808
Englische Ausgabe:
The Twilight Zone
Daunt Books 2022
ISBN: 978-1914198212