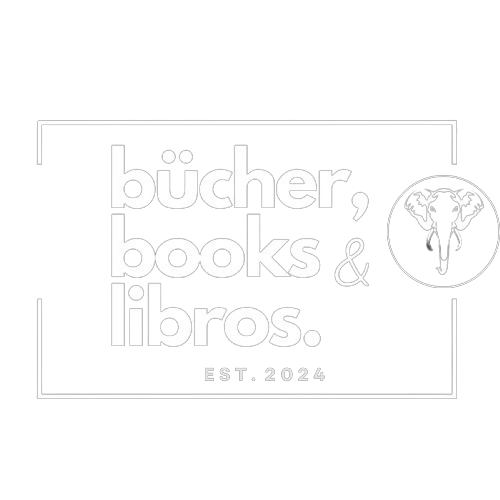Emilia, geboren 1866 in Kalifornien, erzählt ihre Geschichte. Die Großeltern mütterlicherseits waren irische Einwanderer. Ihre Mutter, Molly Walsh, vom goldsuchenden Vater im Waisenhaus vergessen, wird später Novizin in einem katholischen Orden und avanciert schnell zur „heiligen Mary“. Vor ihrer Ewigen Profess wird sie für mehrere Jahre in einer ländlichen Schule eingesetzt. Es kommt, wie es in Romanen kommen muss. Sie wird von einem durchreisenden reichen Chilenen verführt und verlassen, ihre Schwangerschaft und ihre Tochter Emilia sind die „Strafe Gottes“.
Molly heiratet den wesentlich älteren Schuldirektor Francisco Claro. Diese anfangs eher auf Respekt und einer gewissen Zuneigung beruhende Beziehung wandelt sich in eine wahre Liebesgeschichte. Vor allem aber wird Francisco zum eigentlichen Vater für Emilia.
Molly bekommt drei weitere Kinder, steht ihre Frau in diesem Leben, verhärtet aber innerlich wegen des nicht überwundenen Verrats des Chilenen.
Emilia fängt früh an zu schreiben, Groschenromane und Krimis, die sie sich vor allem mit Hilfe ihrer Mutter ausdenkt, kriminelle Phantasie ist ausreichend vorhanden.
Allende, Nichte des ehemaligen chilenischen Staatspräsidenten Salvador Allende (1970-1973) bis zum Militärputsch von Pinochet, zeichnet mit Emilia einmal mehr eine sympathische, durchsetzungsstarke Frau. Sie erkämpft sich eine erste Anstellung bei einer Zeitung in San Francisco und reist dann für diese, man bauchte in dieser Zeit dafür in der dritten Zug-Klasse noch neun Tage, für einige Monate nach New York. Emilia trifft in New York ihre erste große Liebe. Auch wenn der Mann, Bruder ihres Arbeitskollegen Eric, ihr von Beginn an keinen Zweifel daran lässt, dass sie für ihn nur ein Abenteuer ist, ist sie entsetzt, als sie feststellt, dass er sogar verheiratet ist.
Emilia befreit als junge Frau nicht nur ihren Körper vom unnötigen Korsett, sondern im übertragenen Sinn sich selbst und ihr Leben auch von anderen einengenden Regelungen und den rigiden Erziehungsmassstäben ihrer ihrer streng katholischen Mutter. Sie entwickelt sich in New York zur Anhängerin der freien Liebe, und unterstützt die Suffragetten. Sie zieht diese Einstellung den „dezenten Mädchen“ vor, „deren Tugend sich am Ausmaß ihrer Unwissenheit bemisst“. Vor allem aber ist ihr Motto: „Ich ziehe es vor, um Entschuldigung zu bitten statt um Erlaubnis“.
So gut manche Szenen und Begebenheiten sind, die immer mal wieder eingestreuten platten „Lebensweisheiten“ wie „Es gibt keine Freundschaft zwischen Männern und Frauen“, „Was Du nicht willst, das man Dir tu…“ bis hin zu „Tiere töten nur aus Hunger“ stören.
Emilia muss ihre Kolumnen unter dem Pseudonym ihrer Krimis und Groschenromane veröffentlichen, da eine Frau als Journalistin/Reporterin nicht zu vermitteln ist. Das ändert sich 1891 mit dem in Chile beginnenden Bürgerkrieg. Im Auftrag ihrer Zeitung bricht sie mit ihrem Kollegen Eric nach Chile auf, verbunden mit der Hoffnung, dort ihren Erzeuger zu finden und im Gepäck den Auftrag ihrer Mutter, noch ausstehende Rechnungen zu begleichen.
Emilia setzt sich auch in den schwierigen Umständen dieser Reise durch und hat zudem erreicht, dass sie künftig unter ihrem Namen publizieren darf.
Neben der Zeichnung von starken Frauen sind viele Bücher Allendes auch geprägt durch eine kritische Sicht auf die chilenische Geschichte und Gesellschaft. Allende bringt in einer Reihe von Momentaufnahmen die chilenische Gesellschaftsstruktur näher, wenige Familien, meist aristokratisch geprägt, beherrschen das Land. Ihre klassistische, rassistische Einstellung dominiert. Man macht einen feinen Unterschied zwischen „Gesellschaft“ und „Bevölkerung“. Allendes kritischer Blick gilt auch dem chilenischen Selbstbild: „Die beste Rasse, die stärkste Wirtschaft, die stabilste Demokratie, das disziplinierteste Heer, das Vorzeigeland Südamerikas“. Der Roman spielt Mitte des 19. Jahrhunderts, in manchen Aspekten hat sich nicht allzu viel verändert.
In den noch unblutigen Anfangswirren des Bürgerkrieges findet Emilia ihren Erzeuger Gonzalo Andrés del Valle, der, Träger eines der besten Namen der chilenischen Oberschicht, sein gesamtes Erbe durchgebracht hat und nun verarmt und schwer krank seine letzten Tage im Exil in der argentinischen Botschaft verbringt. Trotz der Beeinflussung durch ihre Mutter, die ihren Geliebten immer als Verbrecher bezeichnet hat, nähern sich Emilia und Gonzalo in einer Mischung aus Neugier und Indifferenz an.
Diese Beziehung zu ihrem todkranken Erzeuger, den sie dann irgendwann auch Vater nennt, nimmt eine überraschend positive Entwicklung. Er setzt kurz vor seinem Tod sogar durch, dass seine Tante die letzten Schritte zur Anerkennung Emilias als seine leibliche Tochter vollzieht. Emilia fühlt sich mit Chile zunehmend verwurzelt.
Aus der Hauptstadt Santiago de Chile zieht Emilia in das Kriegsgebiet um Valparaiso, schildert dort verschiedene Schlachten und Kriegsgräuel in aller eindrücklichen Ausführlichkeit. In all diesen blutigen Schrecknissen beginnt, überraschend für beide, die Liebesgeschichte mit ihrem bisherigen Arbeitskollegen und platonischen Freund Eric. Diese Beziehung entwickelt sich in einem Kontext eines von Hass, Gewalttaten und späterer Siegerrache geprägten Bürgerkrieges, der in wenigen Monaten mehr Menschenleben kostete als der vierjährige Krieg Chiles gegen Peru und Bolivien. Der Mensch zeigte sich einmal mehr als das, was er auch sein kann, als Bestie.
Während die bereits erwähnten Momentaufnahmen des chilenischen Gesellschaftsporträts gelungen sind, gilt dies deutlich weniger für die Analyse des historischen Hintergrundes. Die sich gegenüberstehenden Gruppen werden allzu holzschnittartig, ja statisch beschrieben, so dass diesen Bürgerkrieg besser kontextualisierende Entwicklungen unterbelichtet bleiben und man auf Eigenrecherchen angewiesen ist.
Nach dem Sieg der Aufständischen wird Emilia verhaftet und von einem Militärgericht zum Tode verurteilt. Die Schilderung ihrer „letzten“ Stunden in der Todeszelle ist eindrücklich und sehr gelungen, einschließlich ihres selbstironischen Eingeständnisses, dass es „sehr schwierig ist, vor den Toren des Todes Agnostikerin zu sein“, die dann im Gebet Zuflucht sucht.
Ihr Fazit: „Ich würde für etwas sterben, was sich nicht lohnt, genauso wie diese Männer für nichts sterben. Wir waren alle wegwerfbar, anonyme Wesen, Nummern in der historischen Bilanz von Generälen und Politikern“.
Nach all diesen erschütternden Erlebnissen steht für sie fest, dass ihre Zeit als Verfasserin von intimen yellow-press-Kolumnen über das Leben anderer Menschen oder von Groschenromanen vorbei ist. Eine aber noch wichtigere Erkenntnis für sie ist, die eigentliche Erbschaft ihres Vaters nicht in 50 ha Land in der südchilenischen Wildnis, sondern in ihren chilenischen Wurzeln zu sehen. Um diesen weiter nachzugehen und sich selbst zu finden, verliert sie sich über Monate im unwirtlichen araukanischen Süden Chiles. Dieser inhaltlich auch nicht weiter ausgearbeitete Abschluss erscheint mir etwas allzu konstruiert und aufgesetzt. Eric findet sie schließlich und bringt sie mit ihrem in der Wildnis beendeten autobiographisches Manuskript nach Hause. Das ist mir etwas zu sehr Hollywood.
Nach vielen Jahren war das mal wieder ein Allende-Buch. Ich habe nicht alle Bücher von ihr gelesen. Unerreicht für mich ist ihr erstes Buch, „Das Geisterhaus“, sehr lesenswert sind auch „Dieser weite Weg“ und „Mein erfundenes Land“.
Die Wahrnehmung der chilenischen Literatur in Deutschland ist für meinen Geschmack zu Allende-dominiert. Dabei gibt es eine ganze Reihe anderer Schriftsteller, die zu entdecken sich lohnt. Meine große Hoffnung ist daher die Frankfurter Buchmesse 2027 mit dem Gastland Chile. Dies ist eine großartige Chance, dieses spannende Land und die Breite seiner Literatur zu entdecken.
Isabel Allende: Mein Name ist Emilia del Valle
Suhrkamp, ISBN: 978-3518-4322-04
Übersetzerin: Svenja Becker