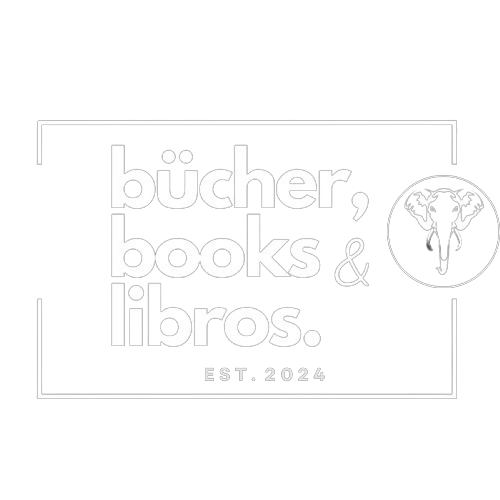Besprechung auf Deutsch! Review also in English!
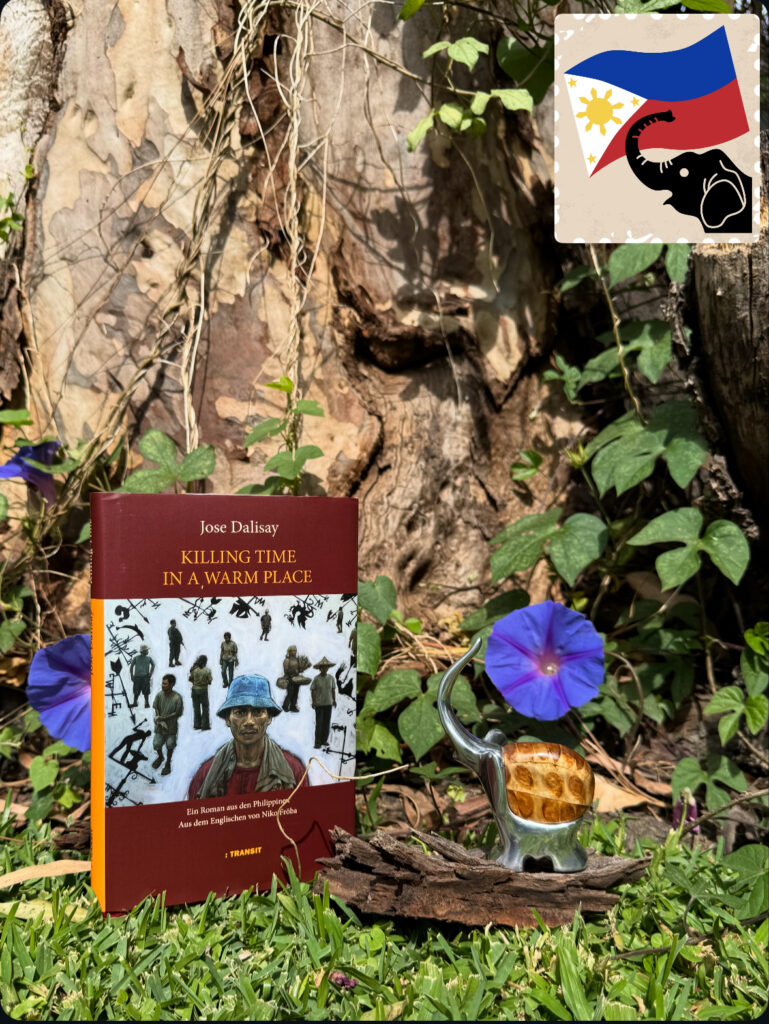
Noel Bulaong heißt der „Held“ dieser in den Philippinen spielenden Geschichte, dem „Land ohne Schnee und Himbeeren. Stattdessen haben wir Sturzregen und Kokosnüsse“. Und die Philippinen haben einen Staatspräsidenten, Ferdinand Marcos, seit 1965 demokratisch gewählter Präsident, der jedoch angesichts des nahenden Endes seiner zweiten Amtszeit immer weniger Lust hat, sich verfassungsgemäß zurückzuziehen und auch deshalb im September 1972 das Kriegsrecht über die Philippinen verhängt.
Die Familie Noels zählt zu den Anhängern des Präsidenten, „Marcos war unser aller Vater“. Noel selbst, Mathematikstudent, Genosse der Kommunistischen Partei und mehr mit Mao als mit Mathe beschäftigt, gibt sein Studium auf und teilt seiner Familie mit, dass er „jedes Interesse am Studium, am Heiraten und am bürgerlichen Leben im Allgemeinen verloren hätte“ und sein Leben künftig deshalb nur noch dem Kampf gegen die Marcos-Diktatur widmen wolle.
Noel zählt nicht zu den führenden Kadern. Er nimmt es mit Selbstironie. Es gab den einen oder anderen gebildeten Theoretiker unter den studentischen Genossen, „während der Rest von uns sich im bäuerlichen Schlammbad des Denkens eines Mao Tse Tung suhlte„.
Und er macht sich, in den Philippinen als dem katholischsten Land in ganz Asien wichtig, auch keine Illusionen: „Natürlich glaubten wir an Marx, aber genauso selbstverständlich glaubten wir an Gott. Wir waren Filipinos und hatten beinah unerschöpfliche Kapazitäten in Glaubensdingen.“
Aber das Ziel ist klar: Sie wollten „alle den US-Imperialismus, den Feudalismus und den bürokratischen Kapitalismus bekämpfen, die Triade, so hieß es, unseres nationalen Elends“.
Dalisay fängt sehr gut die erste Zeit der Kriegsrechtsperiode ein, in der die Sorge um ihre Sicherheit und bereits verschwundene Genossen Noels kleine Gruppe umtreibt. Er nimmt aber auch selbstkritisch wahr, dass „eine gewisse Selbstgefälligkeit…langsam ein(sickerte), eine Geborgenheit in der propagierten Ruhe und nationalen Widerstandsfähigkeit, die alle Schicksalsschläge wirkungslos erscheinen ließen…“.
Auch wenn sich Noel über das von einem Geheimdienst-Major mit besonderen intellektuellen Fähigkeiten entwickelte „Fahndungsraster“ lustig macht, wonach alle Kommunisten „eine Maske trugen, komponiert aus Schuld, Verdorbenheit und unverhohlener Drohung – unzweifelhaft hervorgerufen durch ihren Atheismus, Drogenmissbrauch, ihre verrohten Sitten und die Gier nach Macht“ – offensichtlich fällt er für den Geheimdienst unter diese Kriterien. Und so bleibt von seinem vermeintlich unerschütterlichen Selbstbewusstsein als Teil der revolutionären Avantgarde nicht viel übrig, als er Anfang Januar 1973 im Haus seiner Eltern verhaftet wird und fast acht Monate im Gefängnis verbringt.
Abgesehen von der einleitenden Gefängnisepisode schien zunächst nicht so ganz erkennbar, wohin die ganze Geschichte laufen soll. Auch springt der Roman des Öfteren szenenartig zwischen verschiedenen Epochen hin und her, so dass nicht immer auf Anhieb klar wird, in welcher man sich gerade befindet. Dann gewinnt die Erzählung jedoch an Fahrt und Konsistenz, wird klarer, politischer und der Autor (selbst)kritischer.
Die befreundeten Revolutionäre gehen, sofern sie das Gefängnis überlebt haben, danach alle verschiedene Wege. Manche tauchen in den bewaffneten Untergrund ab. Andere überleben wegen der Todesschwadronen oder Strafmassnahmen ihrer ehemaligen Genossen ihre Freilassung nicht.
Noel geht einen anderen Weg. Dieses stark autobiographisch geprägte Buch ist für José „Butch“ Dalisay der Versuch einer historischen, ja persönlichen Erklärung bis Rechtfertigung, „wie und warum Menschen in den Bann einer Diktatur geraten.“ Das betrifft auch ihn selbst, der sich „in den letzten Jahren der Diktatur als Regierungsangestellter zu ihrem Komplizen gemacht hatte“, so Dalisay in einem Interview Ende 2024.
Urplötzlich begegnen wir Noel im Wagen eines Vize-Ministers, und es bedarf einiger Zeit um zu verstehen, dass er in der Spätphase der Marcos-Regierung nun Teil der verlogenen und korrupten Maschinerie ist, die er früher bekämpfen wollte.
Die Auseinandersetzung mit den Genossen und sich selbst über diesen „Verrat“ zieht sich durch den letzten Teil des Buches.
Noel wird von seinen alten Genossen mit seiner neuen Identität konfrontiert:“Glaubst du an das, was du machst? Antwort:
Nein. Ein bisschen, vielleicht. Das muss ich. Ich muss irgendeinen Sinn darin finden.“ Überzeugt geht anders.
Gegenüber einer ehemaligen Kampfgefährten geht seine Begründung tiefer: „Ich wollte einfach nicht sterben. Als sie mich aus dem Gefängnis entließen, wusste ich, dass ich nicht sterben wollte. Es war einfacher, mir einzureden, dass ich falsch gelegen hatte, aus jugendlichen Leichtsinn, als dass ich auf der richtigen Seite gekämpft hätte und durchhalten müsste, ein Held sein müsste…Wenn andere kämpften, dann, weil auch sie sich weigerten, zu sterben oder zumindest so leben zu müssen, dass sie nicht sie selbst waren. Aber ich hatte keine solchen Gewissensbisse; ich könnte, würde jemand anderes sein, aber leben; ich konnte mit dieser Schuld leben, Und überließ das Gute in mir und die Schmerzen den anderen. Nicht, dass ich mich in die Reihen ihrer Gegner eingliedern wollte – auch wenn ich das in gewisser Weise tat –, aber ich wählte den sicheren, ausgetretenen Pfad der Vergesslichkeit und des geringeren Leids (bespuckt zu werden, vergessen zu werden, auch von sich selbst; vollkommen egal).“
Wer wollte urteilen, wer wirft denen ersten Stein?
Zu diesem Weg hat sicherlich auch beigetragen, Dalisay führt das im erwähnten Interview aus, dass er nach seiner Haftentlassung feststellen musste, dass die „Widerständler“ eine verschwindende Minorität darstellten während die große Mehrheit einer ideologiefernen Bevölkerung zumindest zu Beginn mit dem Kriegsrecht vollkommen einverstanden war und es mit den regierungsseitig verordneten „Prinzipien nationaler Selbstdisziplin und konstruktiver Subordination“ versuchen wollte. Dies in dem Gefühl, dass es „angesichts der grässlichen und stressvollen Unbeständigkeit des Lebens in der übrigen Welt genau jetzt keinen besseren Ort auf er Welt gäbe als die Philippinen mit ihren siebentausendeinhundert von der Sonne geküssten Inseln“.
Abgesehen von diesem roten Faden der Geschichte erfährt man vielfach beiläufig auch so manches andere über die Philippinen. So schildert Dalisay z.B die Folgen der armutsbedingten Binnen-Migration in den Philippinen vor allem in Richtung der Hauptstadt Manila, „der babylonischen Stadt, deren neueste Quartiere sogleich aussehen wie ihre ältesten“ und im vielfach nichts anderes sind als Slums, häufig gebaut auf ehemaligen oder aktiven Müllkippen.
Das Kriegsrecht blieb bis 1981 in Kraft. Marcos wurde nach massivem Wahlbetrug erst durch die sogenannte EDSA-Revolution im Februar 1986 aus dem Amt gejagt und starb 1989 im Exil in Hawaii.
Die Zerrissenheit über sein Verhalten begleitet ihn. Er schafft den Absprung in die USA, ist aber auch dort nicht innerlich frei, sondern fragt sich: „Was oder wen würde ich als Nächstes verraten? Wann würde ich anfangen zu hassen, wozu ich werden würde?“
Dalisay begann diesen Roman 1986, kurz nachdem Sturz der Marcos-Diktatur, erstmals veröffentlicht wurde er 1991. Bittere Ironie der Geschichte: Genau 50 Jahre nach Ausrufung des Kriegsrechts wird der Marcos-Sohn „Bonbong“ 2022 zum philippinischen Staatspräsidenten gewählt.
In seinem Epilog aus dem März 2024 zieht Dalisay ein bedrückendes Fazit: „Knapp 40 Jahre später ist das eigentlich Undenkbare geschehen, die Rechte ist zurück, nicht nur auf den Philippinen, auch in vielen anderen Ländern, die wir für stabile Demokratien hielten. Der Optimismus, der die Welt am Ende des 20. Jahrhunderts erfüllte, ist einem sich verdunkelnden Horizont gewichen, einer Verhärtung der Herzen und einer Einengung des Denkens. Unsere fundamentalen Freiheiten und Werte stehen unter dem harten und unerbittlichen Druck Politischer Kräfte, die, wie wir jetzt erst realisieren, nie, ganz verschwunden waren… Und wieder höre ich die Lockrufe des Despotismus, sehe die glasigen Augen von Menschen, die sich verzweifelt nach einer schnellen Lösung ihrer Probleme sehnen, der sofortigen Heilung. Ich höre Stiefel marschieren, ein Geräusch, das vielen junge Leuten, die Ohren verstopft von lauter Musik, völlig egal zu sein scheint. Sogar unter den Älteren gibt es eine wiedererweckte Sehnsucht nach simpler Ordnung unter der Herrschaft eines starken Mannes… Mein Roman sollte eigentlich von der Vergangenheit handeln. Warum ist er plötzlich wieder so aktuell?“
🇵🇭 📖
José Dalisay: „Killing Time in a warm Place“ , Transitverlag, übersetzt von Nico Fröba
****
Noel Bulaong is the name of the “hero” in this story set in the Philippines, the “land without snow and raspberries. Instead, we have torrential rain and coconuts.” And the Philippines has a president, Ferdinand Marcos, democratically elected in 1965, who, however, with the end of his second term approaching, has less and less desire to step down in accordance with the constitution and therefore imposes martial law on the Philippines in September 1972.
Noel’s family are supporters of the president: “Marcos was our father.” Noel himself, a mathematics student, member of the Communist Party, and more interested in Mao than in math, gives up his studies and informs his family that he has “lost all interest in studying, getting married, and bourgeois life in general” and therefore wants to devote his life to the fight against the Marcos dictatorship.
Noel is not one of the leading cadres. He takes it with self-irony. There were one or two educated theorists among the student comrades, “while the rest of us wallowed in the peasant mud bath of Mao Tse Tung’s thinking.”
And he, who is important in the Philippines, the most Catholic country in Asia, has no illusions: “Of course we believed in Marx, but just as naturally we believed in God. We were Filipinos and had almost inexhaustible capacities when it came to matters of faith.”
But the goal is clear: they wanted “to fight US imperialism, feudalism, and bureaucratic capitalism, the triad, as it was called, of our national misery.”
Dalisay captures very well the early days of martial law, when concerns about their safety and comrades who had already disappeared preoccupied Noel’s small group. But he also self-critically observes that “a certain complacency… slowly seeped in, a sense of security in the propagated calm and national resilience that made all the blows of fate seem ineffective…”
Even though Noel pokes fun at the “search pattern” developed by a secret service major with special intellectual abilities, according to which all communists “wore a mask composed of guilt, depravity, and blatant menace—undoubtedly caused by their atheism, drug abuse, brutalized morals, and lust for power,” he obviously falls under these criteria for the secret service. And so, not much remains of his supposedly unshakeable self-confidence as part of the revolutionary avant-garde when he is arrested at his parents‘ house in early January 1973 and spends almost eight months in prison.
Apart from the introductory prison episode, it was not immediately clear where the whole story was going. The novel also frequently jumps back and forth between different eras, so that it is not always immediately clear which one you are currently in. Then, however, the narrative gains momentum and consistency, becoming clearer, more political, and the author more (self-)critical.
The revolutionary friends, those who survived prison, all go their separate ways. Some go underground and take up arms. Others do not survive their release due to death squads or punitive measures taken by their former comrades.
Noel takes a different approach. This strongly autobiographical book is José “Butch” Dalisay’s attempt at a historical, even personal explanation or justification of “how and why people fall under the spell of a dictatorship.” This also applies to himself, who “had made himself an accomplice to the dictatorship as a government employee in its final years,” as Dalisay said in an interview at the end of 2024.
Suddenly, we encounter Noel in the car of a deputy minister, and it takes some time to understand that in the late phase of the Marcos government, he is now part of the deceitful and corrupt machinery he once wanted to fight.
The confrontation with his comrades and himself about this “betrayal” runs through the last part of the book.
Noel is confronted by his old comrades with his new identity: „Do you believe in what you’re doing? Answer: No. A little, maybe. I have to. I have to find some meaning in it.“ That’s not very convincing.
His reasoning goes deeper when talking to a former comrade-in-arms: „I just didn’t want to die. When they released me from prison, I knew I didn’t want to die. It was easier to convince myself that I had been wrong, out of youthful recklessness, than that I had fought on the right side and had to persevere, had to be a hero… If others fought, it was because they too refused to die, or at least to live in a way that was not true to themselves. But I had no such qualms; I could be someone else, but I could live; I could live with this guilt, and leave the good in me and the pain to others. Not that I wanted to join the ranks of their opponents – even though in a way I did – but I chose the safe, well-trodden path of oblivion and lesser suffering (being spat on, forgotten, even by myself; it didn’t matter).“
Who would judge, who would cast the first stone?
The conflict over his behavior accompanies him. He manages to escape to the US, but even there he is not free inside, asking himself: “What or whom would I betray next? When would I start to hate, what would I become?”
Dalisay certainly contributed to this path. Dalisay explains in the aforementioned interview that after his release from prison, he realized that the “resistance fighters” were a vanishing minority, while the vast majority of a population uninterested in ideology was, at least initially, in complete agreement with martial law and wanted to try the government’s prescribed “principles of national self-discipline and constructive subordination.” This was based on the feeling that “given the gruesome and stressful instability of life in the rest of the world, there was no better place on earth right now than the Philippines with its seven thousand one hundred sun-kissed islands.”
Apart from this central theme of the story, the reader also learns many other things about the Philippines in passing. For example, Dalisay describes the consequences of poverty-driven internal Emigration in the Philippines, especially to the capital Manila, “the Babylonian city whose newest neighborhoods immediately look like its oldest” and are often nothing more than slums, frequently built on former or active garbage dumps.
Martial law remained in force until 1981. After massive election fraud, Marcos was finally ousted from office by the so-called EDSA Revolution in February 1986 and died in exile in Hawaii in 1989.
The conflict over his behavior follows him. He manages to escape to the US, but even there he is not free inside, asking himself: “What or whom would I betray next? When would I start to hate, what would I become?”
Dalisay began this novel in 1986, shortly after the fall of the Marcos dictatorship, and it was first published in 1991. The bitter irony of history: exactly 50 years after martial law was declared, Marcos‘ son “Bonbong” is elected president of the Philippines in 2022.
In his epilogue from March 2024, Dalisay draws a depressing conclusion: „Just under 40 years later, the unthinkable has happened: the right wing is back, not only in the Philippines, but also in many other countries that we considered stable democracies. The optimism that filled the world at the end of the 20th century has given way to a darkening horizon, a hardening of hearts, and a narrowing of minds. Our fundamental freedoms and values are under harsh and relentless pressure from political forces that, as we now realize, never completely disappeared… And once again, I hear the siren calls of despotism, see the glazed eyes of people desperately longing for a quick solution to their problems, for instant healing. I hear boots marching, a sound that seems to be of no concern to many young people, their ears blocked by loud music. Even among the older generation, there is a reawakened longing for simple order under the rule of a strong man… My novel was supposed to be about the past. Why is it suddenly so relevant again?“
🇵🇭 📖
José Dalisay: „Killing Time in a warm Place“, Anvilpublishing , Manila