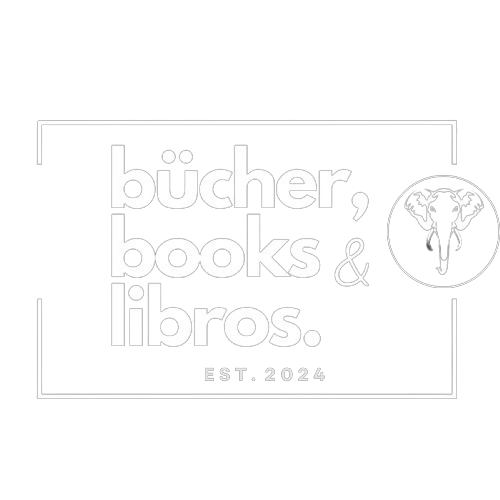BESPRECHUNG AUF DEUTSCH! REVIEW ALSO IN ENGLISH!
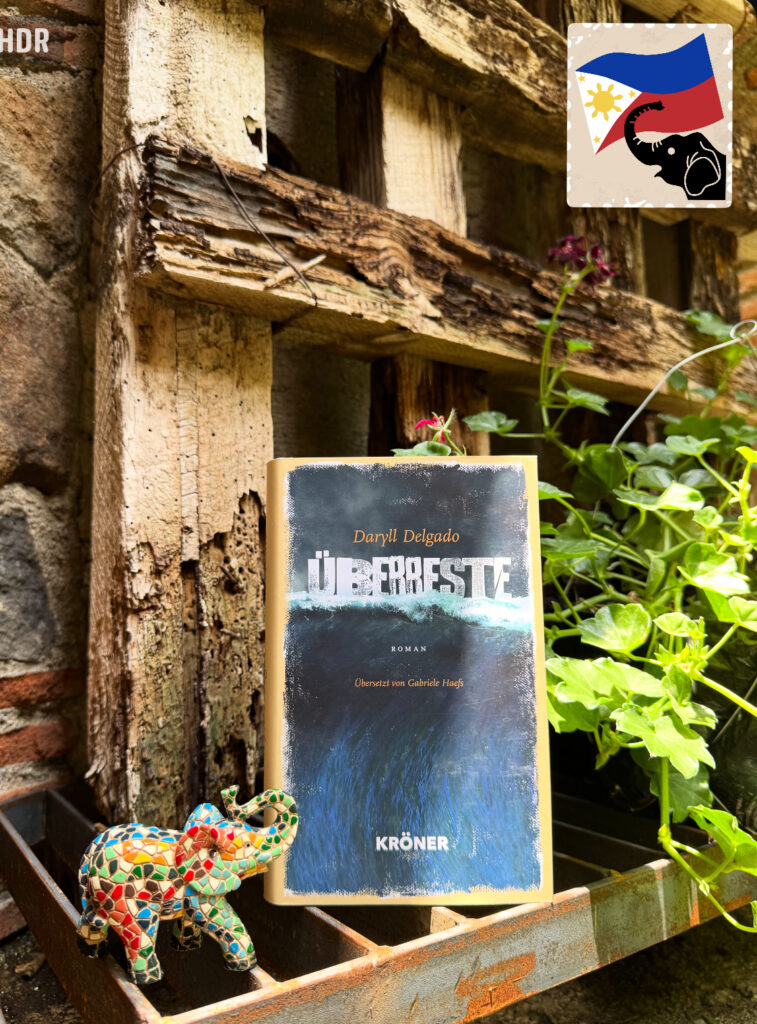
2013 verwüstet der Supertaifun Haiyan („Yolanda“ in den Philippinen), mit mehr als 10 000 Todesopfern einer der schlimmsten, der die Philippinen je heimgesucht hat, die auf der Insel Leyte, einem blutigen Schauplatz des 2. Weltkrieges, gelegene philippinische Stadt Tacloban. Tacloban ist die Heimatstadt der Autorin, ebenso wie der späteren Diktatorengattin Imelda Marcos.
Ann kehrt nach vielen Jahren in ihre Heimatstadt zurück. Sie gehörte während ihrer Studienzeit einer sozialistisch – christlichen Jugendbewegung an, brach ihr Studium ab, verließ ihre Heimatstadt und arbeitet inzwischen in einer internationalen NGO, alles „Adrenalinjunkies“, die in solchen Katastropheneinsätzen zur Höchstform auflaufen. Sie zählt nicht zu den führenden Kräften der NGO, aber ihre Ortskenntnis und der dortigen Sprache, das Waray, hat ihr zur Aufnahme in die Truppe verholfen. Delgado flicht auch immer wieder Worte und Sätze in Waray in ihre Erzählung mit ein, die am Ende des Buches erklärt werden. Delgado in einem Interview: „ Die Figuren sollten denken und reden wie Waray-Sprecher. Ich wollte den Roman auch für meine Waray-Leute schreiben. Sie sollten sich und ihre Stimmen und dem Roman wiederfinden.“
Ann soll in lediglich drei Tagen Material sammeln, um danach Resilienz-Geschichten für das Projekt zusammenzustellen.
Bereits im Anflug sieht Ann, was aus ihrer Stadt geworden ist: „Kaum dass ich sie sah, konnte ich sie schon fast riechen – die Fäulnis, die Verwesung. …Die ehemals grüne Insel sah aus wie ein Tierkadaver.“ Sie kommt in eine Situation von „Finsternis…, Chaos, Tod und Verwüstung“, in der „nicht einmal die Illusion von Normalität aufrechtzuerhalten oder momentweise herzustellen“ ist.
„Es ist, als wäre der imaginäre Deckel auf dieser Provinz, die bekannt ist als Heimat der anderen Hälfte des Diktatorenpaares, endlich weggepustet worden, und unweigerlich entwichen stinkende Ausdünstungen.“
Eine sicherlich nicht nur auf die Naturkatastrophe gemünzte Beschreibung.
Für Ann beginnt angesichts der durch den Taifun verursachten Verwüstung nicht nur eine belastende berufliche Reise, sondern auch eine komprimierte Zeitreise in ihre eigene Vergangenheit. Denn sie bringt einen geheimnisvollen Auftrag ihrer Mutter mit: „Tilge jegliche Spur des verfluchten Hauses, aber verschone die kleinen darum herum“. Für Ann ein angesichts lediglich dreier Tage ein Rennen gegen die Zeit.
Für die olphatisch hypersensible Ann sind diese Tage eine besondere Herausforderung. Die sich mischenden Gerüche, der Gestank von Tod und Verwesung machen sie fertig. „Der Geruch der Lebenden“ ist eine Seltenheit.
Dennoch erweist sie sich aus nicht näher erklärten Gründen als im Kern nicht verletzbar, verwundbar, das Allermeiste lässt sie schlicht nicht an sich heran. Auch wenn diese Katastrophen-Einsätze auf Dauer sicher dazu führen, dass sich die Helfer Schutzmechanismen zulegen, um angesichts des Elends nicht selbst zu zerbrechen, an manchen Stellen erscheint Ann kalt, gefühllos: „Verletzt. Schon wieder dieses Wort. Genauso schlimm wie Resilienz.“ Das „einzige, worüber ich Tränen vergossen habe, war diese verdammte Bestie, dieses Monster“. Gemeint ist damit ein von einem Zaun aufgespießter Tiger. Offen bleibt, ob dieser Tiger das durch die Geschichten der Bewohner von Tacloban geisternde Monster und, so Mano Pater, verantwortlich für den Tod seiner Tochter Lisa ist, einer Jugendfreundin Anns. Die Suche nach Lisa bleibt jedenfalls erfolglos.
Auch das Familiengeheimnis um das „alte Haus“ wird nicht aufgeklärt.
Die Familiengeschichte bleibt weitgehend im Unklaren, nur Bruchstücke werden berichtet.
Breiten Raum nimmt Anns gespaltenes, distanziertes Verhältnis zu ihrer Mutter ein. Diese war mit Imelda, der späteren Frau des Diktators Ferdinand Marcos, befreundet. Ihre Familien pflegten freundschaftlichen Umgang miteinander. Dieses Leben einer gutsituierten, politisch gut vernetzten Mittelstandsfamilie bot die passende Tarnung für ihre Mutter, die sich still und heimlich zu einer Kritikerin des Marcos-Regimes wandelte und während des Kriegsrechts einer Widerstandsgruppe anschloss, ohne dass dies in der Familie jemand bemerkt hätte. Das ist nur eine der Ambivalenzen dieser Familie. In den Worten ihrer ebenfalls in den USA lebenden Schwester Alice: “Keiner in diesem Haus war doch der, der er vorgab zu sein”.
Das schließt auch geheimnisvolle Verhältnis zwischen Mano Pater („älterer Vater“) und ihrem Vater beziehungsweise ihrer Mutter mit ein. Ann ist sich ihrer eigenen Erinnerungen nicht sicher, will aber, „dieses eine Bild von ihm, das nicht besudelt werden wird von meiner Angst, meinen Zweifeln, meiner Schuld oder von was auch immer ich herausfinden werde im Laufe meiner Nachforschungen meiner Recherche“ behalten.
Auch die Hintergründe der Ermordung eines engen Freundes und Mitarbeiters ihres Vaters bleiben im Dunkeln, hängen aber offensichtlich mit der Zeit des Kriegsrechts zusammen. Es war zu dieser Zeit eben alltäglich, dass „in unserer Kindheit Menschen einfach ohne Vorwarnung auftauchten und wieder verschwanden“. Dieses Attentat und das zeitliche Umfeld der EDSA-Revolution, durch die der Militärdiktator Marcos entmachtet und ins Exil getrieben wurde, waren wohl der Anlass für den Umzug der Familie nach Manila und in Folge auch des Auseinanderfallens der Familie. Die Mutter geht ihre eigenen Wege und wandert nach Kalifornien aus. Dort schart sie mit der Zeit eine ihr ergebende Anhängerschar um sich, die sich von ihren Studien zu Identität, Queernis und sozialen Fragen inspirieren lässt.
„Überreste“ ist etwas mehr als der vielfach marketingmäßig etikettierte „Climate-fiction-Roman“. Delgado thematisiert über Naturkatastrophen, wie Taifune, die in den Philippinen zum jährlichen Inventar zählen, eine Reihe von Aspekten philippinischer Realität, die, das hat die Lektüre zahlreicher zur Frankfurter Buchmesse erschienen Romane gezeigt, in nahezu allen zeitgenössischen Romanen vorkommen: die tief verwurzelte Korruption, die Fragmentierung der Gesellschaft, die im Kern eine anhaltende Klassengesellschaft ist, oder die Arbeitsmigration. Und wie in kaum einem philippinischen Roman dürfen auch hier Sagen und Mythen nicht fehlen.
In der Beschreibung von Tod und Verwüstung ist Delgado drastisch, brutal. Da wird nach der Katastrophe nichts romantisiert, das Buch ist daher nicht immer einfach zu lesen.
Die Menschen bewegen sich wie Zombies, was wohl daran liege, „dass sie ausschließlich Instinkt- gesteuert agierten, geleitet von dem Impuls, nicht still zu stehen, sondern zu sein, zu handeln, und am Leben zu bleiben“.
Aufgrund der eingeschobenen Originalberichte von Überlebenden, nicht selten den einzig Überlebenden einer Großfamilie, hat dieser Roman auch einen dokumentarischen Charakter. Tod und Überlebenswille treffen aufeinander, Beispiele von Haltung und Würde mitten im Chaos stechen hervor. Die Rahmenhandlung gewinnt dadurch an bedrückender Authentizität.
Ann wirft dabei auch ein selbstkritisches Bild auf Aufenthalt und Handlungsformen derartiger NGO ´s und deren bei weitem nicht immer positiven Perzeption seitens der Einheimischen.
„Überreste“ ist ein Roman der offenen Enden, der ungelösten Fragen. Bilder, Erinnerungen, Bruchstücke, neue Eindrücke überlagern sich, fügen sich nicht zu einem beruhigenden Gesamtbild. Nicht jede Reise in die eigene Vergangenheit bringt Aufklärung, Erkenntnis oder gar Beruhigung und Aussöhnung.
Das ist alles andere als langweilig, spiegelt vielmehr auf einer anderen Ebene das Chaos der Rahmenhandlung wider. Aber den ein oder anderen erzählerischen Abschluss hätte man sich doch gewünscht.
Dennoch: Ein Leseeerlebnis!
„Überreste“ ist Delgados Debut-Roman (2019) und ihr erster ins Deutsche übersetzte Roman, den sie bereits auf der Buchmesse Leipzig 2025 vorgestellt hat.
Daryll Delgado: Überreste Kröner Verlag
REVIEW IN ENGLISH !!
In 2013, Super Typhoon Haiyan (“Yolanda” in the Philippines) devastated Tacloban, a Philippine city located on the island of Leyte, a bloody battleground during World War II. With more than 10,000 fatalities, it was one of the worst typhoons ever to hit the Philippines. Tacloban is the hometown of the author, as well as the later dictator’s wife, Imelda Marcos.
Ann returns to her hometown after many years. During her studies, she belonged to a socialist-Christian youth movement, dropped out of college, left her hometown, and now works for an international NGO, all of whom are “adrenaline junkies” who rise to their best form in such disaster relief efforts. She is not one of the leading forces in the NGO, but her knowledge of the area and the local language, Waray, helped her to be accepted into the team. Delgado also repeatedly weaves words and sentences in Waray into her narrative, which are explained at the end of the book. Delgado in an interview: „The characters should think and talk like Waray speakers. I also wanted to write the novel for my Waray people. They should be able to recognize themselves and their voices in the novel.“
Ann has only three days to gather material and then compile resilience stories for the project.
Even as she approaches, Ann sees what has become of her city: “As soon as I saw it, I could almost smell it—the rot, the decay. …The once green island looked like an animal carcass.” She finds herself in a situation of „darkness…, chaos, death, and devastation,“ in which ”not even the illusion of normality can be maintained or momentarily created.“
“It is as if the imaginary lid on this province, known as the home of the other half of the dictator couple, has finally been blown off, and stinking fumes have inevitably escaped.”
A description that certainly does not refer only to the natural disaster.
For Ann, the devastation caused by the typhoon marks not only the beginning of a stressful professional journey, but also a condensed journey through time into her own past. For she has brought with her a mysterious assignment from her mother: “Erase every trace of the cursed house, but spare the little ones around it.” For Ann, with only three days to complete the task, it is a race against time.
For the olfactorily hypersensitive Ann, these days are a particular challenge. The mingling smells, the stench of death and decay, overwhelm her. “The smell of the living” is a rarity.
Nevertheless, for reasons that are not explained in detail, she proves to be essentially invulnerable, vulnerable, and simply does not let most things get to her. Even though these disaster relief missions certainly lead to the helpers developing protective mechanisms in the long run so that they do not break down themselves in the face of the misery, Ann appears cold and insensitive in some places: „Hurt. That word again. Just as bad as resilience.“ The ”only thing I shed tears over was that damn beast, that monster.“ She is referring to a tiger impaled on a fence. It remains unclear whether this tiger is the monster that haunts the stories of the residents of Tacloban and, according to Mano Pater, is responsible for the death of his daughter Lisa, a childhood friend of Ann’s. In any case, the search for Lisa remains unsuccessful.
The family secret surrounding the “old house” is also not revealed.
The family history remains largely unclear, with only fragments being reported.
Ann’s conflicted, distant relationship with her mother takes up a lot of space. Her mother was friends with Imelda, who later became the wife of dictator Ferdinand Marcos. Their families maintained friendly relations with each other. This life of a well-off, politically well-connected middle-class family provided the perfect cover for her mother, who quietly and secretly became a critic of the Marcos regime and joined a resistance group during martial law without anyone in the family noticing. This is just one of the ambivalences of this family. In the words of her sister Alice, who also lives in the US: “No one in that house was who they pretended to be.”
This also includes the mysterious relationship between Mano Pater (“older father”) and her father and mother. Ann is unsure of her own memories, but wants to keep “this one image of him that will not be tainted by my fear, my doubts, my guilt, or whatever I will find out in the course of my research.”
The circumstances surrounding the murder of a close friend and colleague of her father also remain unclear, but are obviously linked to the period of martial law. At that time, it was commonplace for “people to simply appear and disappear without warning during our childhood.” This assassination and the timing of the EDSA Revolution, which deposed military dictator Marcos and drove him into exile, were probably the reason for the family’s move to Manila and, subsequently, the breakup of the family. The mother goes her own way and emigrates to California. There, over time, she gathers a devoted following inspired by her studies on identity, queerness, and social issues.
“Remains” is more than just a “climate fiction novel,” as it is often labeled for marketing purposes. Delgado uses natural disasters, such as typhoons, which are an annual occurrence in the Philippines, to address a number of aspects of Philippine reality that, as numerous novels published for the Frankfurt Book Fair have shown, appear in almost all contemporary novels: deep-rooted corruption, the fragmentation of society, which is essentially a persistent class society, and labor migration. And, as in almost no other Philippine novel, legends and myths are also an integral part of this story.
Delgado’s description of death and devastation is drastic and brutal. Nothing is romanticized after the catastrophe, which means that the book is not always easy to read.
People move like zombies, which is probably because “they acted solely on instinct, guided by the impulse not to stand still, but to be, to act, and to stay alive.”
Due to the inclusion of original reports from survivors, often the only survivors of an extended family, this novel also has a documentary character. Death and the will to survive collide, and examples of attitude and dignity stand out amid the chaos. This lends the frame story an oppressive authenticity.
Ann also takes a self-critical look at the presence and actions of such NGOs and their far from always positive perception by the local population.
“Remains” is a novel of open endings and unresolved questions. Images, memories, fragments, and new impressions overlap, failing to form a reassuring overall picture. Not every journey into one’s own past brings enlightenment, insight, or even reassurance and reconciliation.
This is anything but boring; rather, it reflects the chaos of the plot on another level. But one would have liked to see a narrative conclusion here and there.
Nevertheless: a reading experience!
“Remakes“ is Delgado’s debut novel (2019) and her first novel to be translated into German, which she already presented at the Leipzig Book Fair in 2025.
Daryll Delagdo: Remains. Ateneo de Naga University Press