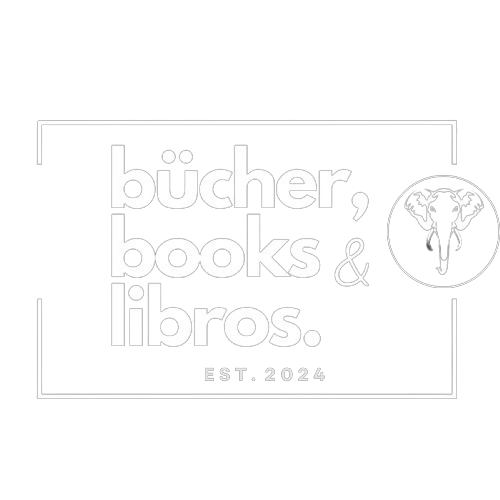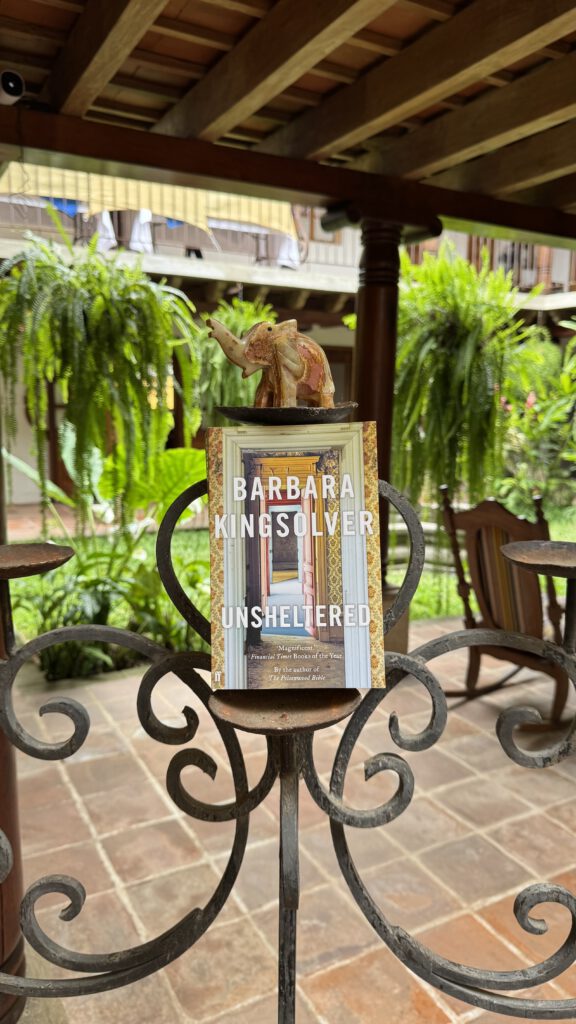
Wir lernen zwei US-amerikanische Familien kennen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Vor allem aber leben diese Familien in verschiedenen Jahrhunderten. Familie Knox treffen wir kurz vor der ersten Trump-Präsidentschaft, Familie Greenwood in der Zeit der Präsidentschaft von Ulysses S. Grant (1869-1977).
Sie eint, dass sie aufgrund des beruflich-akademischen Nomadentums der Ehemänner in Vineland/New Jersey landen und ihre beiden, gegenüber gelegenen Häuser sich in einem abrissreifen Zustand befinden.
Mit dieser Hiobsbotschaft beginnt der Roman für die Familie Knox.
Willa Knox, Mittfünfzigerin, arbeitslose Journalistin, verheiratet mit Iano, griechischer Abstammung, macht eine schwierige Zeit durch. Ein Jahr zuvor sind ihre Mutter und Tante verstorben, ihr Schwiegervater, schwerer Pflegefall und Trump-hardliner, der auch unabhängig von seiner politischen Einstellung ein egoistischer Kotzbrocken sein kann, ist eine zunehmende häusliche Belastung, und mit ihrer Tochter Tig, von Antigone, hat sie auch keine tragfähige Beziehung aufbauen können. Tig wiederum befindet sich in einer Dauerfehde mit ihrem im Investmentbereich arbeitenden älteren Bruder Zeke, Verständigung und Verständnis gleich Null. Auf der anderen Seite ist sie aber voller Verständnis und Fürsorge für ihren ebenso kranken wie unerträglichen Großvater.
Und wie das so ist im Leben: Manchmal hat man kein Glück, und dann kommt noch Pech dazu. In der Nacht nach der Hausbotschaft begeht Willas depressive Schwiegertochter Selbstmord und lässt ihren Mann Zeke mit dem wenige Wochen alten Sohn zurück.
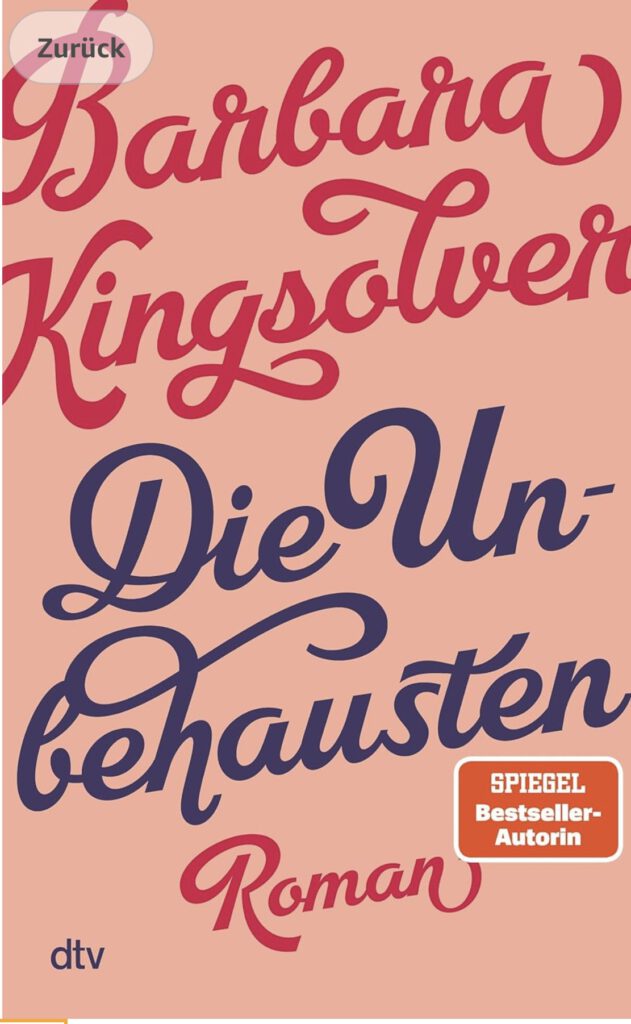
Das führt dann zur berechtigten Frage, wie „zwei hart arbeitende Menschen alles richtig machen im Leben, und dann in ihren Fünfzigern mit leeren Händen dastehen“. Ihre Tochter Tig ist da realistischer: Alles richtig zu machen bringt einem „a big fucking nothing“!
Thatcher Greenwood, lebt mit seiner Frau Rose, deren Schwester Polly und ihrer Mutter in einem ebenfalls abrissgefährdeten Haus. Die Belastung dieser Ehe liegt darin, dass es Thatcher zwar gelungen ist, auf der sozialen Leiteretwas aufzusteigen und Rose, ihren sozialen Abstieg halbwegs zu managen, ihre Beziehung sich aber wegen des Gewichts ihrer unterschiedlichen Herkunft in einer schwierigen Balance befindet.
Auch wenn es mit abrissreifen Häusern beginnt, die „Unbehaustheit“ geht weit über die Frage einer Unterkunft, des Wohnens, der Reparatur oder des Abrisses eines Haues hinaus. Behaust zu sein, im schlichten Sinne von ein „Dach über dem Kopf“ zu haben, ist dabei vielleicht sogar oft das am einfachsten zu lösende Problem.
Man bemerkt erst langsam, in welche Dimensionen menschlichen Lebens und Fragens einem dieser Roman hineinzieht. Immer öfter wird der Begriff „unbehaust“ in neue Zusammenhänge gestellt, gewinnt dadurch seine Faszination und Tiefe, und wirft geradezu philosophische Fragen auf, ohne dass der Roman sich in philosophische Erörterungen oder universitär-akademische Höhenflüge versteigt.
„Unbehaustheit“ beschreibt zum einen eine (multidimensionale) Verlusterfahrung, sei sie materieller Natur wie der Verlust von Haus, Job oder Ersparnissen oder immaterieller Natur wie der Verlust eines geliebten Menschen.
Der Begriff umfasst aber auch schlichte Unsicherheitserfahrung. Wie sich zurechtfinden und Hilfe finden im Dschungel des US-amerikanischen Gesundheitssystems, durch dessen Raster so viele Menschen fallen? Oder wie umgehen mit dem permanenten Damoklesschwert des Jobverlustes, der Instabilität, der wirtschaftlichen Situation, eines immer wieder erforderlichen Umzugs und damit verbundener örtlicher und sozialerEntwurzelung?
Tig äußerst hier scharfe Kritik. Die Jagd nach Sicherheit in Form einer beruflichen Dauerstellung habe die langfristige Gemeinschaft der Familie geopfert.
Die beiden wichtigsten Dimensionen scheinen mir jedoch die folgenden zu ein.
Zum einen eine Situation, in der man auch in einer Ehe zunehmend allein sein kann. Diese Erfahrung macht Thatcher Greenwood. Während er als engagierter Lehrer und Naturwissenschaftler arbeitet, erschöpft sich das Leben seiner Frau und deren Familie in der Geborgenheit des sozialen Mainstreams Gleichgestellter, in Status, mehr Schein als Sein und der Dominanz materieller Werte. Seine Frau interessiert sich nicht im Geringsten für seine Arbeit oder Gedanken, man redet und lebt miteinander aneinander vorbei, Thatcher fühlt sich unsichtbar im eigenen Haus und in seiner Ehe alles andere als behaust.
Er findet kommunikative und intellektuelle Zuflucht bei der Nachbarin, Mary Treat. Die intensiver werdenden wissenschaftlichen Diskussionen zwischen ihnen, gemeinsmae Interessen und das vertraute Zusammensein führen dazu, dass Thatcher den Eindruck hat, Mary könne in seine Seele blicken.
Treat, eine bekannte Biologin (1830-1923), korrespondiert selbst mit Charles Darwin und Asa Gray.
So fiktiv die Handlung und die Personen auch sind, hier kommt nun der historisch belegte Hintergrund zum Tragen: Die erbitterte Auseinandersetzung über die Thesen von Charles Darwin in seinem Ende 1859 veröffentlichten Buch „Über die Entstehung der Arten“. Diese Debatte wird auch im kleinen Vineland zum zentralen Thema.
In diesem Streit wird deutlich, dass die Begriffe von „Fundament“, „Dach“ und „Behaustheit“ in dem Moment geradezu metaphysische Dimensionen annehmen können, in dem tradierte Weltsichten, Glaubensgewissheiten und die Überzeugung, im Besitz der alleinigen Wahrheit zu sein, in Frage gestellt werden. So kommt es nach vielen Vorgeplänkeln zum öffentlichen Showdown zwischen Thatcher und seinem Schuldirektor Cutler. Für diesen, der alle Lehren wörtlich aus der Bibel zieht, ist Darwin der Leibhaftige, der Gottes Schöpfung leugnet. Disziplin und moralische Erziehung sind die Pfeiler seiner Pädagogik, da hat kritisches Denken ebenso wenig zu suchen wie die Suche nach neuen Erkenntnissen. Nicht einmal für Toleranz, ein anderes Denken wenigstens zu akzeptieren, bleibt Raum. Die Wahrheit durch Gott zu finden, wird höher veranschlagt als die eigene Vernunft.
Diese „vollständige Orientierungslosigkeit im Universum“ ruft viele Aggressionen auf den Plan. Mary: „Ich vermute, es liegt in unserer Natur. Wenn Menschen fürchten, ihre Gewissheiten zu verlieren, werden sie jedem Tyrannen folgen, der ihnen verspricht, die alte Ordnung wiederherzustellen“. Eine zeitlose Diagnose.
In einer öffentlich inszenierten Debatte wird schnell klar, dass Thatcher auf verlorenem Posten steht und seine Stelle an der Schule verlieren wird. Für Mary wenig überraschend: Die alten Mythologien sind für die meisten Menschen eine Komfortzone. Nur sehr wenige sind in der Lage, den Wegfall dieser Mythologien als Chance für neues Sehen zu nehmen. Selbst die so rationale Mary sagt, dass man ohne „Behaustsein“ wie im Tageslicht steht und es sich anfühlt wie Sterben.
Alle Charaktere in diesem Roman sind eindrücklich geschildert, keiner bleibt blass. Schlichtweg Freude bereitet die Entwicklung der zunächst nahezu unbemerkt zur Hauptfigur und Heldin heranreifenden Tig, die sich als tiefgründiger entpuppt als das problematische Wesen, als das sie eingangs geschildert wurde.
Ja, sie hat ein anderes Sicherheitsverständnis als ihre Eltern: Ja, es mag sich anfühlen wie sterben, wenn man das Dach über den Kopf verliert, „aber mit Sicherheit findest du keinen Ausweg aus diesem Mist, wenn du weiter Steine aufhebst und in deine Taschen steckst, was du machen musst, ist nach blauem Himmel zu suchen“.
Sie will kein Leben im Hamsterrad und sieht in geringeren Erwartungen auch die Chance auf mehr Glück. Sie scheut aber auch keine Verantwortung. Sie ist vielmehr diejenige, die über einen äußerst lebensnahen, und trotz ihrer Jugend nahezu lebensgestählten Praxissinn verfügt und in der Lage ist, sich an veränderte Umstände anzupassen, Aufgaben und lebensverändernde Herausforderungen zu akzeptieren und anzugehen, wie kaum ein anderer in dieser Familie die Richtung vorzugeben.
So banal es auch klingt, nichts hält für ewig und der Mensch ist notgedrungen immer im Wandel und auf der Suche begriffen. Behaust, beschützt zu sein oder zu bleiben, beinhaltet daher auch, diesen Wandel anzunehmen und zu gestalten versuchen. Dies führt dann auch zur Frage nach den Konstanten, die solche Wechsel erträglich machen. Im Falle von Willa und Iano ist dies sicherlich ihre jahrzehntelange Liebe zueinander.
Nach dem Aus in Vineland ergibt sich für Willa und Iano eine neue berufliche Perspektive in Philadelphia. Das Auspacken lange vergessener Kisten, das Sichten, Aussortieren und Wegwerfen als Sinnbild des „alten Lebens“ und Beginn eines neuen Abschnittes wird sehr schön und eindrücklich geschildert. Jeder dürfte diese Erfahrung schon mal gemacht haben.
Willa findet im Heimatmuseum Unterlagen von Thatcher und Mary, darunter eine von Thatcher stammende Zeichnung mit einer Widmung an Mary: „Unbehaust lebe ich im Tageslicht. Und wie ein umherziehender Vogel ruhe ich in Dir“. Auch Thatcher, der schließlich von den „Seinen“ vertrieben wird, findet eine neue „Behausung“.
Man begleitet beide Familien in ihrem Auf und Ab. Da wird nichts beschönigt oder idealisiert, das Leben wird nicht zum romanhaften Ponyhof. Es findet auch nicht alles und jeder ein Happy End.
Für mich bleibt aber eine positive, optimistische Grundbotschaft des Buches: Es gibt immer einen anderen Weg, Auswege, neue Optionen. Aber es formuliert auch eine Herausforderung: Das „Behaustsein“ sollte nicht um jeden Preis gesucht werden, man sollte auch einstehen für die eigene Auffassung, auch gegenüber Widerständen, auch wenn der Preis hoch sein mag.
„Unsheltered“, „Die Unbehausten“, ist Kingsolvers drittes Buch (2018). Es war mein erstes, wird aber nicht mein letztes bleiben. Neben „Demon Copperhead“, ein monatelanger Hype auf allen Kanälen, liegen „The Poisonwoodbible“/„Die Giftholzbibel“ und „The Bean Trees“ bereit. Ich freue mich darauf, diese Autorin weiter zu entdecken.
Die Unbehausten
dtv
Übersetzt von Dirk van Gusteren
ISBN: 978-3423284639
Unsheltered
Faber&Faber
ISBN: ISBN-10
0571347029
ISBN-13
978-0571347025