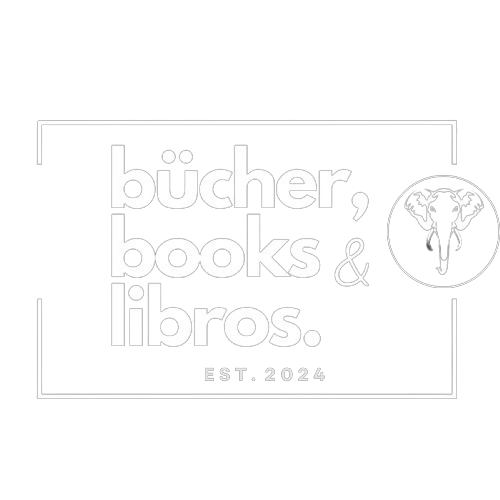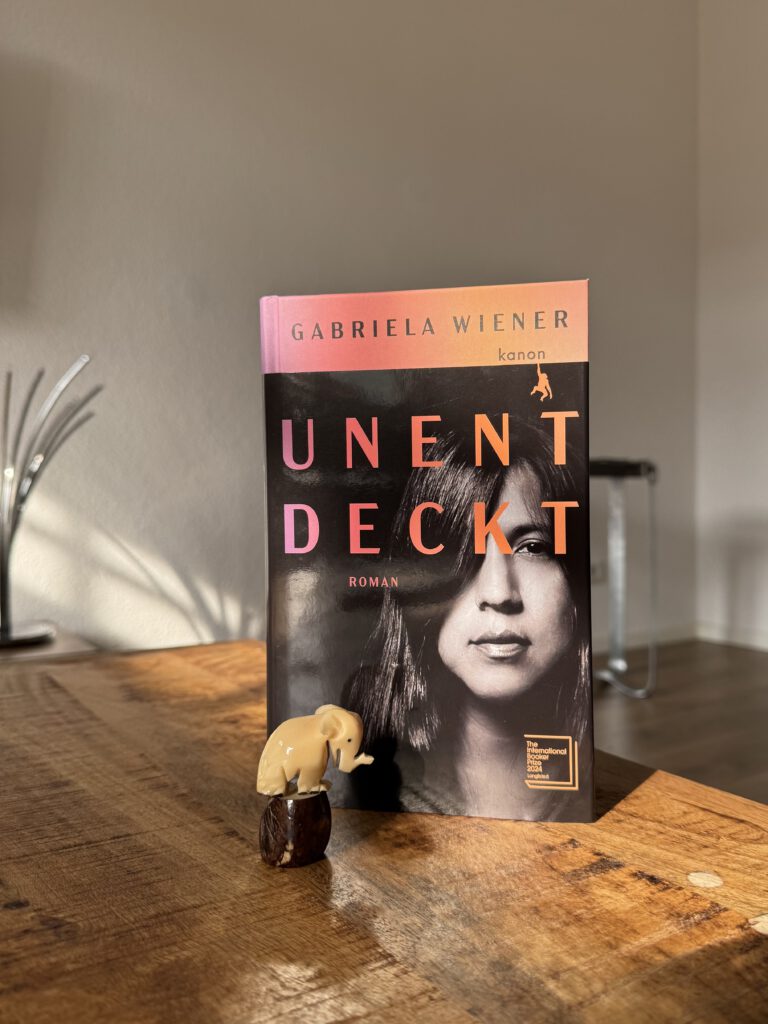
RESEÑA TAMBIÈN EN ESPAÑOL!
Dieser Roman der peruanischen Autorin Gabriela Wiener, 2024 für den International Booker Prize gelistet, verwebt zwei Erzählstränge miteinander. Die Themen „Kolonialismus“ und „Identität“ sowie peruanische und europäische Geschichte werden miteinander verknüpft, Fakten und Imagination ergeben eine interessante Mischung.
Wir schließen Bekanntschaft mit Charles (Karl) Wiener (1851-1913), einer Wiener jüdischen Familie entstammend, die nach dem Tod des Vaters nach Paris übersiedelte. Karl wurde Deutschlehrer und bekannt durch seine 2-jährige Forschungsreise nach Peru und Bolivien und ist, Restzweifel bestehen, wohl der Ururgroßvater der Autorin.
Wiener ist Autor eines 900-Seiten Werkes über Peru und Bolivien, das in der Familie als „Familienbibel“ verehrt wird und die Grundlage für die Legende Wieners bildet, „des bescheidenen Deutschlehrers, der über Nacht zum Indiana Jones wird“. Unumstritten ist er jedoch nicht, da er offensichtlich vor allem auch gut verstand, sich in Szene zu setzen.
Der ganz große Ruhm blieb ihm insofern verwehrt, als er zwar 40 Jahre vor der Entdeckung von Machu Picchu weitgehend richtige Angaben zu dessen Lage machte, es aber aufgrund eines Irrtums letztlich doch nicht fand. Der Entdeckerruhm sollte dann an Hiram Bingham fallen. Dennoch machte er sich durch seine Reise, sein Buch, vor allem aber die Übergabe Tausender archäologischer Stücke an Frankreich in seinem Gastland einen Namen, seine Konversion zum Katholizismus, die den „Schmerz über das Nichtsein im Dasein“ zumindest linderte, half dabei.
Seine Ururuenkelin hat jedoch ein ambivalentes, überwiegend kritisches Verhältnis zu ihrem Ahnen, den sie schlichtweg als „huaquero“, als „Grabräuber“ bezeichnet. Sie sieht weniger einen Wissenschaftler in ihm als einen Plünderer: Wissenschaft ist Vergangenheit rekonstruieren, Plündern jedoch bedeutet „Öffnen, Eindringen, Rausreißen, Rauben, Fliehen, Vergessen“. Das Konzept des „nationalen Kulturerbes“ war noch nicht erfunden. Sie tut sich auch schwer mit seinem Buch, kommt schon über die ersten Seiten nicht hinweg wegen der Aussagen über die „wilden indios“: “Nichts von dieser deplatzierten Figur, so eurozentristisch, gewaltsam und grauenhaft rassistisch, hatte etwas mit mir zu tun, auch wenn meine Familie ihn glorifizierte“.
Der peruanische Zweig der Wieners soll auf einen unehelichen Sohn aus einer Beziehung von Charles mit einer Peruanerin zurückgehen: „Es ist erstaunlich, wie in dieser Familie jahrzehntelang der Stolz auf den Patriarchen und die Scham, von ihm verlassen worden zu sein, zusammengingen“.
Zur Familiengeschichte, hinsichtlich des Verbleibs des Jungen jedoch erfolglosen Recherche zählt auch, dass Wiener einer Indio-Frau ihren kleinen Sohn abgekauft und mit nach Europa genommen hat. So sehr die Autorin das Vorgehen und die Schilderung des Vorgangs durch ihren Ahnen kritisiert, so hebt sie hervor, dass Charles nicht die Idee der Ausrottung unterstützte, sondern „stattdessen vertraute auf den Fortschritt und Regeneration. Charles zufolge hatte nicht nur die spanische Krone diese Völker geschwächt, sondern dann auch ihre Erben, die weißen Eliten der Kreolen in Peru, die die Nachkommen der grandiosen Inkas immer weiter und weiter unterdrückten und ausbeuteten, bis sie unvermeidlich zu Abfall wurden“. Charles kennzeichnet ein „fassungsloser Unglaube, wie die großartige Vergangenheit, die von diesen Völkern errichtet wurde, zu dieser „so mittelmäßigen, so armen, so kleinen“Welt werden konnte. Weil sie „als Barbaren verdammt, verurteilt und ausgelöscht“ wurden“.
Charles kümmert sich um die Entwicklung und Erziehung des Jungen und für ihn ist bewiesen, „dass diese Rasse für ihren Fortschritt nicht mehr bedurfte als Beispiel und Unterweisung.
So wird auch die Grundlage für eine weitergehendere Kritik an den Auswüchsen des Kolonialismus gelegt. So schildert die Autorin die verschiedenen, mit der Weltausstellung in Paris 1889 begonnenen „Themenausstellungen“ oder „Menschenschauen“, zutreffender als „Menschenzoo“ bezeichnet. In diesen wurden Indigene, aus verschiedenen Erdteilen nach Europa verbracht, dem Publikum in ihrer „natürlichen Umgebung“ präsentiert. Der letzte dieser Menschenzoos wurde erst 1958 Belgien geschlossen.
Frankreich tat sich mit einer derartigen Show „Tahuantinsuyo“ (dies war das in vier Himmelsrichtungen unterteilte Inka-Reich) hervor und trifft auf die harsche Kritik der Autorin: „Es ist der aufklärerische Fingerzeig des französischen Szientismus auf die Barbarei der spanischen Monarchie, umgewandelt in einen kritischen Vergnügungspark. Und natürlich ist es eine bigotte Selbstverherrlichung. Während die Franzosen in Peru die Archäologen spielen, halbieren sie die schwarze Bevölkerung Afrikas und legen die Grundlagen für einen wissenschaftlichen Rassismus“.
Diese menschenverachtende Einrichtung stellt ein Desiderat in der historischen Aufarbeitung des Kolonialismus in einer Reihe europäischer Staaten. Zu nennen ist beispielsweise die Debatten um die Aufarbeitung des Themas „Menschenzoo“ und Zirkus Hagenbeck in Hamburg,.
Im zweiten Erzählstrang geht es um die Autorin selbst, ihre eigene Identität als „India“, als „Braune“. Sie fragt sich, ob ihr Ururgroßvater mit Blick auf sein „zivilisatorisches Projekt“ mit ihr zufrieden wäre oder es als gescheitert ansähe. Sie sieht sich als „zugleich Nachkommin des Wissenschaftlers und eines seiner archäologischen und anthropologischen Studienobjekte“.
Die Auseinandersetzung mit ihrem Ahnen berührt die Frage ihrer auch sexuellen Identität.
Die Autorin berichtet von Hierarchien, ja einer Art von Rassismus innerhalb der Familie und Ehen. So sprach ihre Großmutter, eine „Chola“, ihren Ehemann und auch ihren Sohn immer mit „Don“ an, denn beide waren „weißer“ als sie. Die Familien ihrer Großeltern kamen aus verschiedenen Welten: „Beide Familien hatten ziemlich bescheidene Wurzeln, aber in Lima macht es einen gewaltigen Unterschied, ob man arm ist und die Vorfahren aus Ancashoder Monsefú stammen, oder ob man arm ist, aber mit europäischen Vorfahren“. Auch macht sie auf eine bis heute anzutreffende Erfahrung in Lateinamerika aufmerksam: Man lehnt seine Identität selbst ab, da sie arm bedeutet, und dies kann nur überwunden werden, wenn man andere diskriminiert.
Sie selbst erlebt in Spanien alltäglich Rassismus. So werden Südamerikaner in Spanien häufig als „Sudacas“ bezeichnet: „Sudaca….Süden und Kacka in einem Wort“. Auf dem Spielplatz wird sie als Kindermädchen ihre Sohnes betrachtet, die Mutter ihrer Geliebten kommt überhaupt nicht auf die Idee, dass sie sich bei ihr um etwas anderes als eine Putzhilfe handeln könnte.
Das Problem der Autorin besteht darin, dass für sie die Rasse die „Hälfte des Selbst“ ausmacht und ihre (Teil)Identitäten in einem permanenten Widerstreit liegen: „Meine Identität als Braune, Chola und Sudaca versucht die Wiener in mir zu übertönen“.
Als ob dies nicht schon ausreichen würde, kommt zu dieser Problematik ihre komplexe polyamore Beziehung mit ihrem Mann, ihrer Frau und ihrer Tochter hinzu. Geprägt durch ihre eigenen regelwidrigen Eskapaden, verbunden mit einer tiefsitzenden Unsicherheit und Eifersucht
(„Ich stamme aus einer Familie wo zuerst Dein Verstand stirbt und erst danach die Eifersucht“) gestaltet sich auch dieses Verhältnis immer komplizierter. Überlagert wird das alles durch den Tod ihres Vaters, zu dessen Beerdigung sie nach Lima reist, wobei die Geschichte seines dreißigjährigen Ehebruchs mit einer anderen Frau und Tochter ebenfalls aufgearbeitet werden muss.
Für sich selbst führt die Autorin ihre biographischen Erfahrungen, beide Erzählstränge schließlich in der Beteiligung an einer Selbsthilfegruppe „Mein Begehren dekolonisieren“ zusammen.
Der 2021 erschienene spanische Originaltitel lautet: „Huacoretrato“, das bezeichnet die indigene-Inka-Porträtkeramik, eine Art „prähispanisches Passfoto“: „Diese Abbilder indigener Gesichter sind so realistisch, dass es für viele von uns ist, als würden wir in einen vor Jahrhunderten zerbrochenen Spiegel schauen“.
Ich fand das einen passenderen Titel für das Buch als die deutsche Übersetzung „Unentdeckt“ zum Ausdruck bringen kann.
„Unentdeckt“ ist ein lesenswertes Buch über Erinnerungsarbeit, Familiengeschichte, Abschiede, Tod, Identitäten und der Auseinandersetzung mit einer in Kolonialzeiten begonnenen, selbst nicht verschuldeten bzw. zu verantwortenden, aber zu tragenden Familiengeschichte.
Unentdeckt
Kanon Verlag 2025
ISBN 978-3-398568-165-5
Übersetzt von Friederike von Criegern
Huaco retrato 2021
Randomhouse
Undiscovered 2024
Puschkin Press