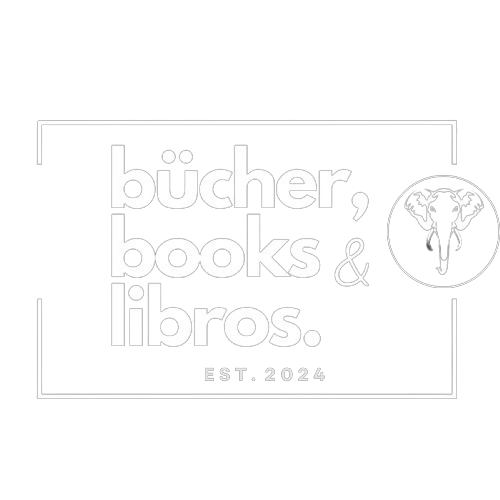Ein versöhnlicher Roman? Jehovas Kicaj konfrontiert uns in ihrem Debütroman „é“ mit einer dramatischen Phase europäischer Zeitgeschichte, der Rückkehr des Krieges nach Europa in Gestalt der Balkankriege in den 90 er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Sie führt uns in ein Land, den Kosovo, in dem die Zeitrechnung sich nicht mehr nach der Geburt Christi richtet, vielmehr werden „vergangene Jahre…in zwei Zeitspannen unterteilt: vor und nach dem Krieg“. Dieser berührende und nachwirkende Roman schildert die schwierige Suche nach der eigenen Sprache, nach Formen der psychischen wie physischen Überwindung der Sprachlosigkeit. Er zeigt, wie mit der Überwindung des Schweigens auch das traumatische Verschweigen gebrochen werden und therapeutisch wirken kann, auf der persönlichen wie der Ebene eines Landes, eines Volkes. Ein simpler Zahnarztbesuch legt das Zusammenwirken von Psyche und Physis offen und setzt einen tiefgehenden, schmerzhaften Selbstfindungsprozess der Ich-Erzählerin in Gang, dessen Dreh- und Angelpunkt die Sprache ist. Trotz ihres „Zermahlens jedes einzelnen Wortes“ gelingt es ihr, die „Zähne als die bewaffneten Hüter des Mundes“, dieses „Urbildes aller Gefängnisse“ zu öffnen und sich langsam zu befreien. Die Selbstverortung der Erzählerin ist illusionslos: „Ich komme aus der Sprachlosigkeit“. Gott sei Dank für das Thema und den Leser hat sie diese Sprachlosigkeit in einer bewundernswerten, klaren und einfühlsamen Sprache überwunden. Die Ich-Erzählerin wächst als kleines Mädchen in Deutschland auf, geographisch in sicherer Distanz von dem Krieg in ihrer Heimat, aber dennoch geprägt von ihm. Sie ist in ihrem Schweigen gefangen. Auch der von der Lehrerin eingesetzte „Erzählstein“ kann sie nicht zum Sprechen bringen. Ein frühes Kindheitsbild kann sie für den Klassenkalender nicht beisteuern:„Dass das fehlende Bild für den Versuch meiner Auslöschung stand, würde ich erst viel später begreifen.“ Auch kann sie sich „nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, an einen früheren Ort zurückzukehren und alles so vorzufinden, wie es war. Für mich gab es immer nur Zerstörung“. „é“ veranschaulicht, dass dieser Krieg, dieser Genozid nicht urplötzlich, nicht aus dem „Nichts“ kam. Die Atmosphäre zwischen den Volksgruppen war bereits lange vor dem Krieg vergiftet. Es herrschte ein abgrundtiefes Misstrauen. Ein von der Nachbarin geschenktes Osterei durfte aus Angst vor Vergiftung nicht gegessen werden. Es gab eine vielfacettige Vorgeschichte. Auch hier spielte die Sprache eine große Rolle. Albanische und serbische Kinder wurden in den Schulen getrennt unterrichtet. Serbisch wurde Anfang der 90er Jahre zur verpflichtenden Nationalsprache, Albanisch am Arbeitsplatz zu sprechen führte zur Kündigung: „Deine Muttersprache konnte Dich in Gefahr bringen, wenn du sie am falschen Ort sprachst“. Anschaulich wird geschildert, wie die Albaner angesichts dieser alltäglichen Unterdrückung begannen, einen „Schatten-Staat“ aufbauen:„Albanischer Unterricht hat in privaten Häusern stattgefunden, in Wohnzimmern, in Kellern“. „é“ verbindet Familien – und nationale Geschichte auch vor dem Hintergrund kosovarischer Märchen und Legenden, in denen die Zunge, womit wieder die zentrale Rolle der Sprache betont wird, eine besondere Rolle spielt. Geschildert werden entsetzliche Details dieser Kriegsverbrechen: Verfolgung, Tod, Ermordung, Hinrichtungen, Massaker, bis heute Tausende von Verschwundenen. Die Existenzen ihres Vaters und Onkels, die vor diesem Krieg 25 Jahre in Deutschland gearbeitet und sich im Kosovo etwas aufgebaut hatten wurden komplett zerstört. Die serbische Kriegstaktik der „verbrannten Erde“ wollte alles vernichten, damit eine Rückkehr in den Kosovo nicht mehr möglich sei. In immer wiederkehrenden Sequenzen wird veranschaulicht, wie präsent dieser Krieg bis heute in den Familien ist. Videos der Familie aus der Vergangenheit, das ständige Verfolgen von speziellen Internet-Plattformen, von Forensik-Berichten, der Verhandlungen vor dem Internationalen Strafgericht für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag sind Teil des Alltags. Für viele Über- und Weiterlebende gilt der Satz einer Überlebenden Mutter des Massakers von Suhareka: „Ich bin eigentlich schon tot, seit meine Kinder gestorben sind. Ich bleibe nur noch am Leben, um Zeugnis darüber abzulegen, was in Suhareka geschehen ist“. Dieser Roman sensibilisiert auch für unterschiedliche Perzeption von Ereignissen. So wurde der damalige Außenminister der GRÜNEN, Joschka Fischer, wegen seiner Befürwortung der NATO-Intervention auf einem Parteitag der GRÜNEN Opfer einer schmerzhaften Farbbeutelatacke, während die von diesem Krieg betroffenen Menschen dankbar für diese humanitäre Intervention der Nato waren. Ich habe mich gefragt, ob dieser Roman ein versöhnlicher Roman ist. Ich denke, eher nicht. Vielmehr geht es aus sehr nachvollziehbaren Gründen der Autorin darum, sich selbst zu vergewissern, zu erinnern, eine angemessene Sprache für all die Gräuel zu finden, und auch Veranwortlichkeiten zu benennen, anzuklagen, alles unabdingbare Bestandteile einer historischen Aufarbeitung. Der Krieg ist seit langem beendet, viele Probleme des Miteinander in der Region und in den einzelnen Staaten sind aber weiterhin vorhanden. Auch wenn „é“ daher eher kein versöhnlicher Roman ist, so ist er doch einer, der brutal klar macht, dass die erlebten, erlittenen Formen der Auseinandersetzung zu nichts anderem als unermesslichem menschlichem Leid führen. Dazu zählt, dass es sich bei zahlreichen vermeintlichen Problemen um nichts anderes als ideologisiert-aufgeputschte Themen handelt. Das „é“ ist im Albanischen ein stimmloser Vokal am Ende von manchen Wörtern. Die Sprachlosigkeit, die Suche nach einer Stimme spiegelt sich im Titel des Buches wieder. Ich hoffe, dass wir von dieser Stimme noch mehr hören und lesen werden. Jehona Kicaj: é, Wallsteinverlag