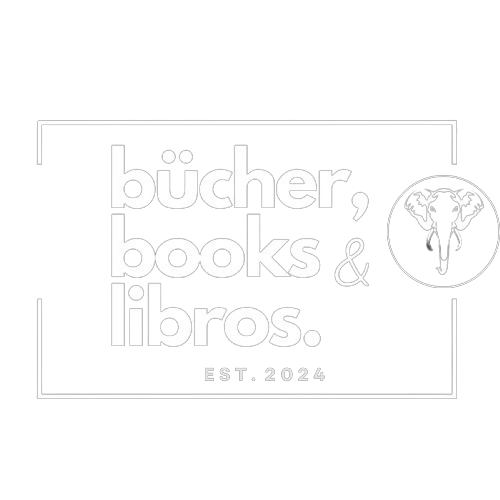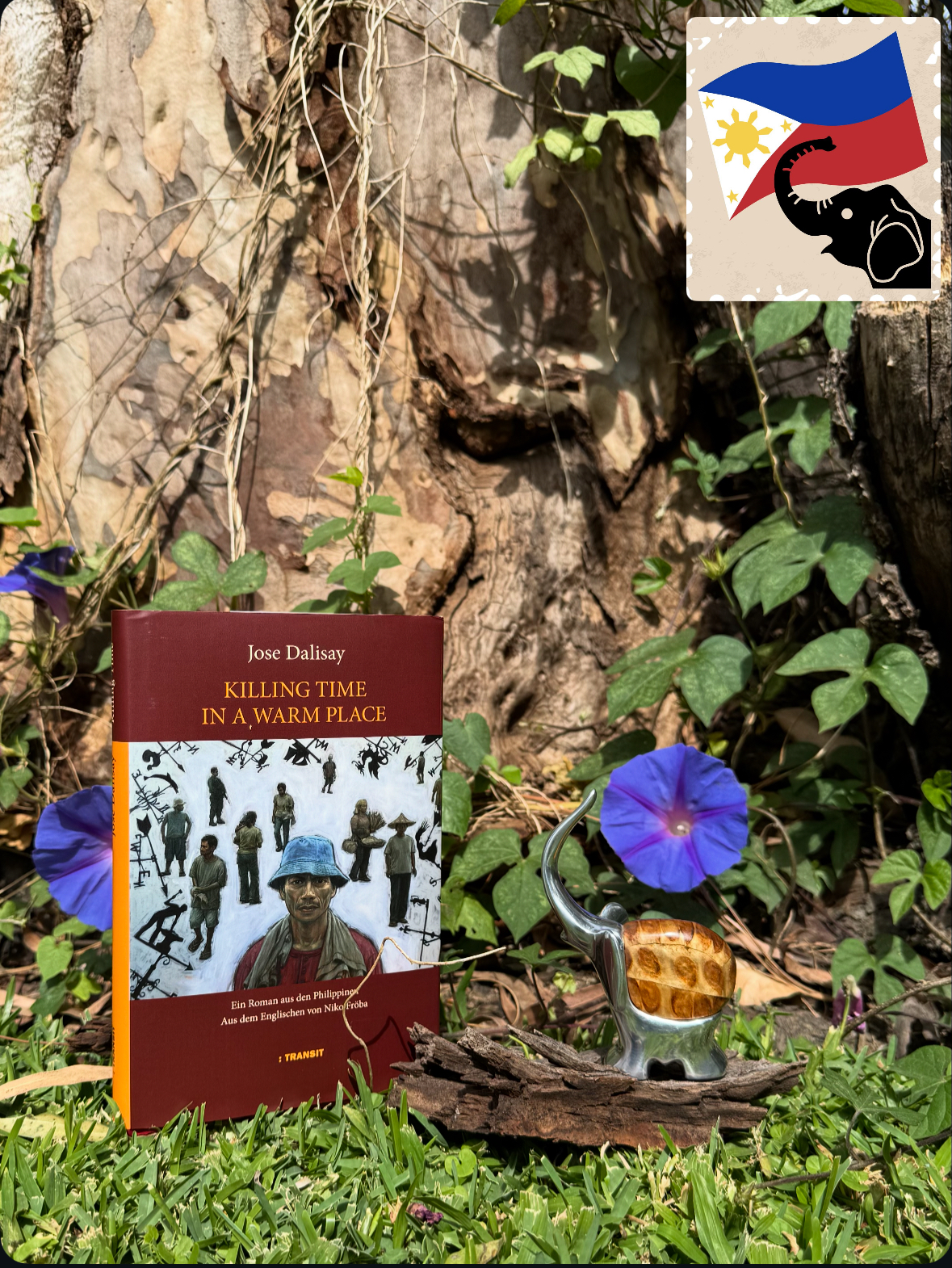Besprechung auf Deutsch! Review also in English! Noel Bulaong heißt der „Held“ dieser in den Philippinen spielenden Geschichte, dem „Land ohne Schnee und Himbeeren. Stattdessen haben wir Sturzregen und Kokosnüsse“. Und die Philippinen haben einen Staatspräsidenten, Ferdinand Marcos, seit 1965 demokratisch gewählter Präsident, der jedoch angesichts des nahenden Endes seiner zweiten Amtszeit immer weniger Lust hat, sich verfassungsgemäß zurückzuziehen und auch deshalb im September 1972 das Kriegsrecht über die Philippinen verhängt. Die Familie Noels zählt zu den Anhängern des Präsidenten, „Marcos war unser aller Vater“. Noel selbst, Mathematikstudent, Genosse der Kommunistischen Partei und mehr mit Mao als mit Mathe beschäftigt, gibt sein Studium auf und teilt seiner Familie mit, dass er „jedes Interesse am Studium, am Heiraten und am bürgerlichen Leben im Allgemeinen verloren hätte“ und sein Leben künftig deshalb nur noch dem Kampf gegen die Marcos-Diktatur widmen wolle. Noel zählt nicht zu den führenden Kadern. Er nimmt es mit Selbstironie. Es gab den einen oder anderen gebildeten Theoretiker unter den studentischen Genossen, „während der Rest von uns sich im bäuerlichen Schlammbad des Denkens eines Mao Tse Tung suhlte„. Und er macht sich, in den Philippinen als dem katholischsten Land in ganz Asien wichtig, auch keine Illusionen: „Natürlich glaubten wir an Marx, aber genauso selbstverständlich glaubten wir an Gott. Wir waren Filipinos und hatten beinah unerschöpfliche Kapazitäten in Glaubensdingen.“ Aber das Ziel ist klar: Sie wollten „alle den US-Imperialismus, den Feudalismus und den bürokratischen Kapitalismus bekämpfen, die Triade, so hieß es, unseres nationalen Elends“. Dalisay fängt sehr gut die erste Zeit der Kriegsrechtsperiode ein, in der die Sorge um ihre Sicherheit und bereits verschwundene Genossen Noels kleine Gruppe umtreibt. Er nimmt aber auch selbstkritisch wahr, dass „eine gewisse Selbstgefälligkeit…langsam ein(sickerte), eine Geborgenheit in der propagierten Ruhe und nationalen Widerstandsfähigkeit, die alle Schicksalsschläge wirkungslos erscheinen ließen…“. Auch wenn sich Noel über das von einem Geheimdienst-Major mit besonderen intellektuellen Fähigkeiten entwickelte „Fahndungsraster“ lustig macht, wonach alle Kommunisten „eine Maske trugen, komponiert aus Schuld, Verdorbenheit und unverhohlener Drohung – unzweifelhaft hervorgerufen durch ihren Atheismus, Drogenmissbrauch, ihre verrohten Sitten und die Gier nach Macht“ – offensichtlich fällt er für den Geheimdienst unter diese Kriterien. Und so bleibt von seinem vermeintlich unerschütterlichen Selbstbewusstsein als Teil der revolutionären Avantgarde nicht viel übrig, als er Anfang Januar 1973 im Haus seiner Eltern verhaftet wird und fast acht Monate im Gefängnis verbringt. Abgesehen von der einleitenden Gefängnisepisode schien zunächst nicht so ganz erkennbar, wohin die ganze Geschichte laufen soll. Auch springt der Roman des Öfteren szenenartig zwischen verschiedenen Epochen hin und her, so dass nicht immer auf Anhieb klar wird, in welcher man sich gerade befindet. Dann gewinnt die Erzählung jedoch an Fahrt und Konsistenz, wird klarer, politischer und der Autor (selbst)kritischer. Die befreundeten Revolutionäre gehen, sofern sie das Gefängnis überlebt haben, danach alle verschiedene Wege. Manche tauchen in den bewaffneten Untergrund ab. Andere überleben wegen der Todesschwadronen oder Strafmassnahmen ihrer ehemaligen Genossen ihre Freilassung nicht. Noel geht einen anderen Weg. Dieses stark autobiographisch geprägte Buch ist für José „Butch“ Dalisay der Versuch einer historischen, ja persönlichen Erklärung bis Rechtfertigung, „wie und warum Menschen in den Bann einer Diktatur geraten.“ Das betrifft auch ihn selbst, der sich „in den letzten Jahren der Diktatur als Regierungsangestellter zu ihrem Komplizen gemacht hatte“, so Dalisay in einem Interview Ende 2024. Urplötzlich begegnen wir Noel im Wagen eines Vize-Ministers, und es bedarf einiger Zeit um zu verstehen, dass er in der Spätphase der Marcos-Regierung nun Teil der verlogenen und korrupten Maschinerie ist, die er früher bekämpfen wollte. Die Auseinandersetzung mit den Genossen und sich selbst über diesen „Verrat“ zieht sich durch den letzten Teil des Buches. Noel wird von seinen alten Genossen mit seiner neuen Identität konfrontiert:“Glaubst du an das, was du machst? Antwort: Nein. Ein bisschen, vielleicht. Das muss ich. Ich muss irgendeinen Sinn darin finden.“ Überzeugt geht anders. Gegenüber einer ehemaligen Kampfgefährten geht seine Begründung tiefer: „Ich wollte einfach nicht sterben. Als sie mich aus dem Gefängnis entließen, wusste ich, dass ich nicht sterben wollte. Es war einfacher, mir einzureden, dass ich falsch gelegen hatte, aus jugendlichen Leichtsinn, als dass ich auf der richtigen Seite gekämpft hätte und durchhalten müsste, ein Held sein müsste…Wenn andere kämpften, dann, weil auch sie sich weigerten, zu sterben oder zumindest so leben zu müssen, dass sie nicht sie selbst waren. Aber ich hatte keine solchen Gewissensbisse; ich könnte, würde jemand anderes sein, aber leben; ich konnte mit dieser Schuld leben, Und überließ das Gute in mir und die Schmerzen den anderen. Nicht, dass ich mich in die Reihen ihrer Gegner eingliedern wollte – auch wenn ich das in gewisser Weise tat –, aber ich wählte den sicheren, ausgetretenen Pfad der Vergesslichkeit und des geringeren Leids (bespuckt zu werden, vergessen zu werden, auch von sich selbst; vollkommen egal).“ Wer wollte urteilen, wer wirft denen ersten Stein? Zu diesem Weg hat sicherlich auch beigetragen, Dalisay führt das im erwähnten Interview aus, dass er nach seiner Haftentlassung feststellen musste, dass die „Widerständler“ eine verschwindende Minorität darstellten während die große Mehrheit einer ideologiefernen Bevölkerung zumindest zu Beginn mit dem Kriegsrecht vollkommen einverstanden war und es mit den regierungsseitig verordneten „Prinzipien nationaler Selbstdisziplin und konstruktiver Subordination“ versuchen wollte. Dies in dem Gefühl, dass es „angesichts der grässlichen und stressvollen Unbeständigkeit des Lebens in der übrigen Welt genau jetzt keinen besseren Ort auf er Welt gäbe als die Philippinen mit ihren siebentausendeinhundert von der Sonne geküssten Inseln“. Abgesehen von diesem roten Faden der Geschichte erfährt man vielfach beiläufig auch so manches andere über die Philippinen. So schildert Dalisay z.B die Folgen der armutsbedingten Binnen-Migration in den Philippinen vor allem in Richtung der Hauptstadt Manila, „der babylonischen Stadt, deren neueste Quartiere sogleich aussehen wie ihre ältesten“ und im vielfach nichts anderes sind als Slums, häufig gebaut auf ehemaligen oder aktiven Müllkippen. Das Kriegsrecht blieb bis 1981 in Kraft. Marcos wurde nach massivem Wahlbetrug erst durch die sogenannte EDSA-Revolution im Februar 1986 aus dem Amt gejagt und starb 1989 im Exil in Hawaii. Die Zerrissenheit über sein Verhalten begleitet ihn. Er schafft den Absprung in die USA, ist aber auch dort nicht innerlich