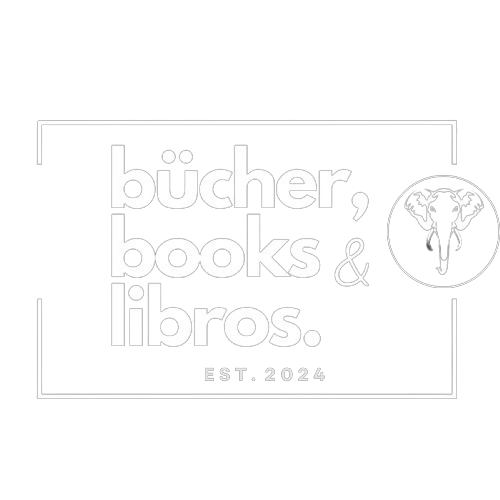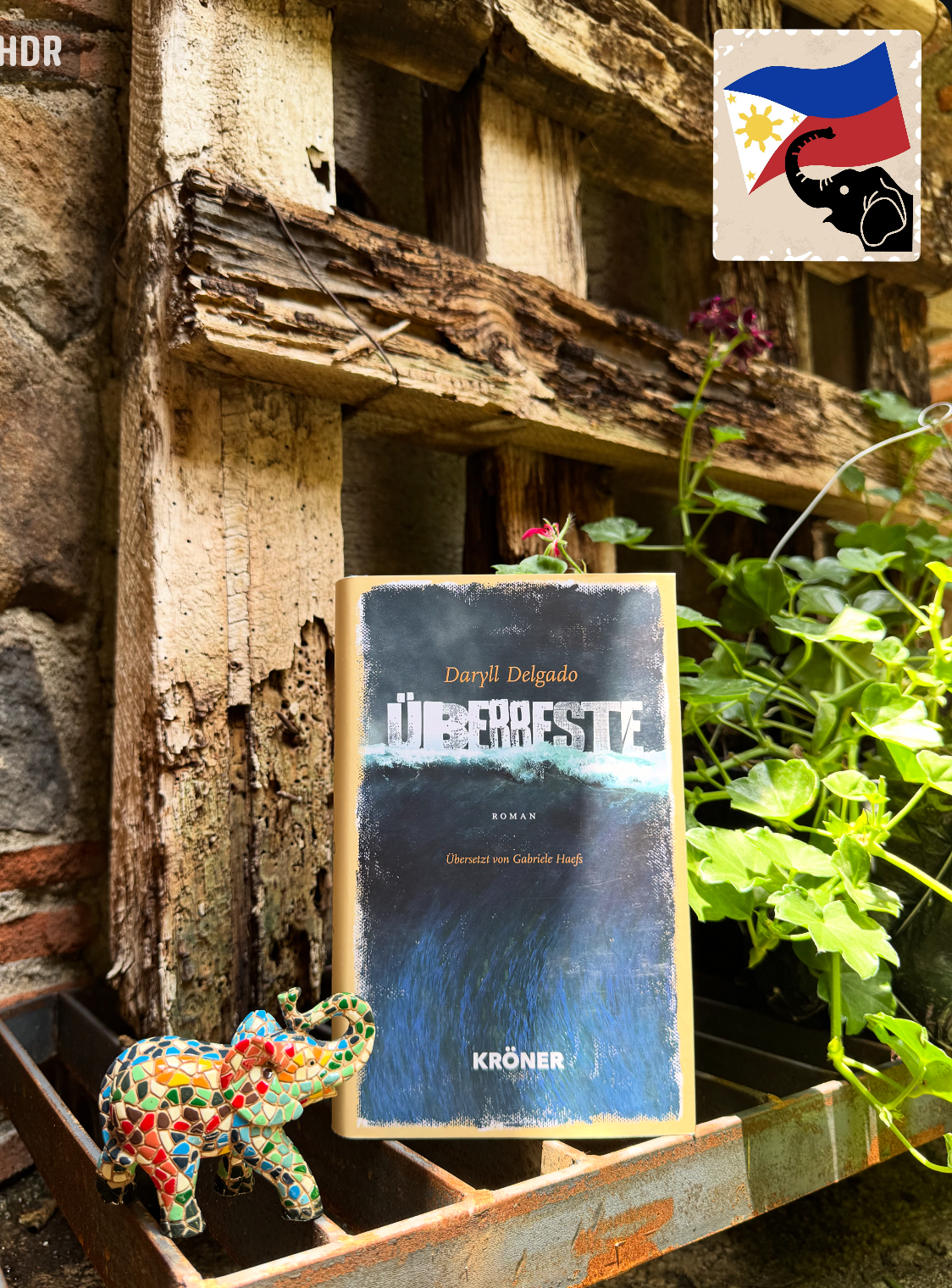BESPRECHUNG AUF DEUTSCH! REVIEW ALSO IN ENGLISH! 2013 verwüstet der Supertaifun Haiyan („Yolanda“ in den Philippinen), mit mehr als 10 000 Todesopfern einer der schlimmsten, der die Philippinen je heimgesucht hat, die auf der Insel Leyte, einem blutigen Schauplatz des 2. Weltkrieges, gelegene philippinische Stadt Tacloban. Tacloban ist die Heimatstadt der Autorin, ebenso wie der späteren Diktatorengattin Imelda Marcos. Ann kehrt nach vielen Jahren in ihre Heimatstadt zurück. Sie gehörte während ihrer Studienzeit einer sozialistisch – christlichen Jugendbewegung an, brach ihr Studium ab, verließ ihre Heimatstadt und arbeitet inzwischen in einer internationalen NGO, alles „Adrenalinjunkies“, die in solchen Katastropheneinsätzen zur Höchstform auflaufen. Sie zählt nicht zu den führenden Kräften der NGO, aber ihre Ortskenntnis und der dortigen Sprache, das Waray, hat ihr zur Aufnahme in die Truppe verholfen. Delgado flicht auch immer wieder Worte und Sätze in Waray in ihre Erzählung mit ein, die am Ende des Buches erklärt werden. Delgado in einem Interview: „ Die Figuren sollten denken und reden wie Waray-Sprecher. Ich wollte den Roman auch für meine Waray-Leute schreiben. Sie sollten sich und ihre Stimmen und dem Roman wiederfinden.“ Ann soll in lediglich drei Tagen Material sammeln, um danach Resilienz-Geschichten für das Projekt zusammenzustellen. Bereits im Anflug sieht Ann, was aus ihrer Stadt geworden ist: „Kaum dass ich sie sah, konnte ich sie schon fast riechen – die Fäulnis, die Verwesung. …Die ehemals grüne Insel sah aus wie ein Tierkadaver.“ Sie kommt in eine Situation von „Finsternis…, Chaos, Tod und Verwüstung“, in der „nicht einmal die Illusion von Normalität aufrechtzuerhalten oder momentweise herzustellen“ ist. „Es ist, als wäre der imaginäre Deckel auf dieser Provinz, die bekannt ist als Heimat der anderen Hälfte des Diktatorenpaares, endlich weggepustet worden, und unweigerlich entwichen stinkende Ausdünstungen.“ Eine sicherlich nicht nur auf die Naturkatastrophe gemünzte Beschreibung. Für Ann beginnt angesichts der durch den Taifun verursachten Verwüstung nicht nur eine belastende berufliche Reise, sondern auch eine komprimierte Zeitreise in ihre eigene Vergangenheit. Denn sie bringt einen geheimnisvollen Auftrag ihrer Mutter mit: „Tilge jegliche Spur des verfluchten Hauses, aber verschone die kleinen darum herum“. Für Ann ein angesichts lediglich dreier Tage ein Rennen gegen die Zeit. Für die olphatisch hypersensible Ann sind diese Tage eine besondere Herausforderung. Die sich mischenden Gerüche, der Gestank von Tod und Verwesung machen sie fertig. „Der Geruch der Lebenden“ ist eine Seltenheit. Dennoch erweist sie sich aus nicht näher erklärten Gründen als im Kern nicht verletzbar, verwundbar, das Allermeiste lässt sie schlicht nicht an sich heran. Auch wenn diese Katastrophen-Einsätze auf Dauer sicher dazu führen, dass sich die Helfer Schutzmechanismen zulegen, um angesichts des Elends nicht selbst zu zerbrechen, an manchen Stellen erscheint Ann kalt, gefühllos: „Verletzt. Schon wieder dieses Wort. Genauso schlimm wie Resilienz.“ Das „einzige, worüber ich Tränen vergossen habe, war diese verdammte Bestie, dieses Monster“. Gemeint ist damit ein von einem Zaun aufgespießter Tiger. Offen bleibt, ob dieser Tiger das durch die Geschichten der Bewohner von Tacloban geisternde Monster und, so Mano Pater, verantwortlich für den Tod seiner Tochter Lisa ist, einer Jugendfreundin Anns. Die Suche nach Lisa bleibt jedenfalls erfolglos. Auch das Familiengeheimnis um das „alte Haus“ wird nicht aufgeklärt. Die Familiengeschichte bleibt weitgehend im Unklaren, nur Bruchstücke werden berichtet. Breiten Raum nimmt Anns gespaltenes, distanziertes Verhältnis zu ihrer Mutter ein. Diese war mit Imelda, der späteren Frau des Diktators Ferdinand Marcos, befreundet. Ihre Familien pflegten freundschaftlichen Umgang miteinander. Dieses Leben einer gutsituierten, politisch gut vernetzten Mittelstandsfamilie bot die passende Tarnung für ihre Mutter, die sich still und heimlich zu einer Kritikerin des Marcos-Regimes wandelte und während des Kriegsrechts einer Widerstandsgruppe anschloss, ohne dass dies in der Familie jemand bemerkt hätte. Das ist nur eine der Ambivalenzen dieser Familie. In den Worten ihrer ebenfalls in den USA lebenden Schwester Alice: “Keiner in diesem Haus war doch der, der er vorgab zu sein”. Das schließt auch geheimnisvolle Verhältnis zwischen Mano Pater („älterer Vater“) und ihrem Vater beziehungsweise ihrer Mutter mit ein. Ann ist sich ihrer eigenen Erinnerungen nicht sicher, will aber, „dieses eine Bild von ihm, das nicht besudelt werden wird von meiner Angst, meinen Zweifeln, meiner Schuld oder von was auch immer ich herausfinden werde im Laufe meiner Nachforschungen meiner Recherche“ behalten. Auch die Hintergründe der Ermordung eines engen Freundes und Mitarbeiters ihres Vaters bleiben im Dunkeln, hängen aber offensichtlich mit der Zeit des Kriegsrechts zusammen. Es war zu dieser Zeit eben alltäglich, dass „in unserer Kindheit Menschen einfach ohne Vorwarnung auftauchten und wieder verschwanden“. Dieses Attentat und das zeitliche Umfeld der EDSA-Revolution, durch die der Militärdiktator Marcos entmachtet und ins Exil getrieben wurde, waren wohl der Anlass für den Umzug der Familie nach Manila und in Folge auch des Auseinanderfallens der Familie. Die Mutter geht ihre eigenen Wege und wandert nach Kalifornien aus. Dort schart sie mit der Zeit eine ihr ergebende Anhängerschar um sich, die sich von ihren Studien zu Identität, Queernis und sozialen Fragen inspirieren lässt. „Überreste“ ist etwas mehr als der vielfach marketingmäßig etikettierte „Climate-fiction-Roman“. Delgado thematisiert über Naturkatastrophen, wie Taifune, die in den Philippinen zum jährlichen Inventar zählen, eine Reihe von Aspekten philippinischer Realität, die, das hat die Lektüre zahlreicher zur Frankfurter Buchmesse erschienen Romane gezeigt, in nahezu allen zeitgenössischen Romanen vorkommen: die tief verwurzelte Korruption, die Fragmentierung der Gesellschaft, die im Kern eine anhaltende Klassengesellschaft ist, oder die Arbeitsmigration. Und wie in kaum einem philippinischen Roman dürfen auch hier Sagen und Mythen nicht fehlen. In der Beschreibung von Tod und Verwüstung ist Delgado drastisch, brutal. Da wird nach der Katastrophe nichts romantisiert, das Buch ist daher nicht immer einfach zu lesen. Die Menschen bewegen sich wie Zombies, was wohl daran liege, „dass sie ausschließlich Instinkt- gesteuert agierten, geleitet von dem Impuls, nicht still zu stehen, sondern zu sein, zu handeln, und am Leben zu bleiben“. Aufgrund der eingeschobenen Originalberichte von Überlebenden, nicht selten den einzig Überlebenden einer Großfamilie, hat dieser Roman auch einen dokumentarischen Charakter. Tod und Überlebenswille treffen aufeinander, Beispiele von Haltung und Würde mitten im Chaos stechen hervor. Die Rahmenhandlung gewinnt dadurch an bedrückender Authentizität. Ann wirft dabei auch ein selbstkritisches Bild auf Aufenthalt und Handlungsformen derartiger NGO ´s und deren bei