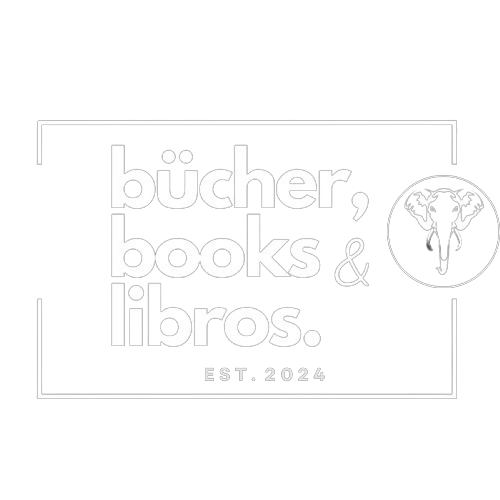Besprechung auf Deutsch! Review also in English!
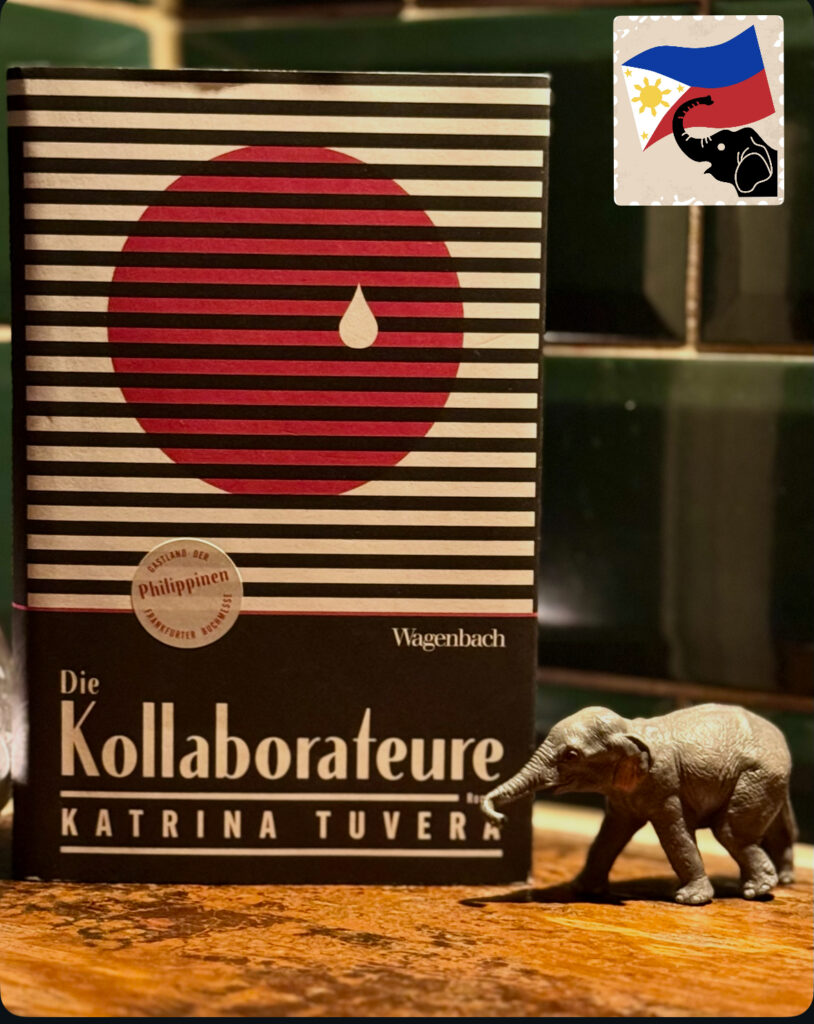
Kollaborateure, „Quislinge“, sind kein spezifisch philippinisches Thema. Zu allen Zeiten und in allen Weltgegenden waren und sind sie zu finden.
Die jahrhundertelange Kolonisierungsgeschichte der Philippinen (seit 1565 spanische Kolonie, nach kurzer Unabhängigkeit 1898 unter US-amerikanischer Kontrolle, während des 2. Weltkrieges zwischen 1942-1945 von den Japanern besetzt und erst 1946 unabhängig geworden, bietet jedoch ein vielfältiges Panorama zur Entfaltung der unterschiedlichsten Formen und Ausprägungen von Kollaboration.
Wo endet Komplizenschaft, wo beginnt Verrat? Was ist überlebensnotwendige Anpassung bis Kooperation, wo beginnt die karrierebewußte, opportunistische Kollaboration? Und: „Wie zieht man…den Propagandisten zur Rechenschaft, den Einflüsterer, den Missetäter, all jene, die einfach weggesehen haben“?
Diesem spannenden und komplexen Thema widmet sich Tuvera in ihrem ersten auf Deutsch erschienen Roman.
Es beginnt mit der turbulenten Phase der Amtsenthebung von Staatspräsident Estradas wegen eines Korruptionsskandals um die Jahrtausendwende. Während die Auseinandersetzungen auf der Straße und im Parlament toben, liegt Carlos Armando in seinen letzten Zügen, was seine Frau und Tochter nicht davon abhält, ihr gegenseitiges Unverständnis auszuleben.
Carlos erinnert sich an seine Kindheit, seine Schulzeit während der japanischen Besatzung und die Verfolgung der Kollaborateure, an die erste Zeit mit Renata, seiner Frau, vor allem aber an sein in den 60 er Jahren beginnendes Politikerleben. Selbstkritik beschränkt sich jedoch allenfalls auf die zu wenige Zeit, die er mit seiner Tochter Brynn verbracht hat. Ansonsten findet er für alles, sofern er überhaupt etwas hinterfragt, eine Erklärung, eine Rechtfertigung.
Sein engster Freund Damian, ein mit allen Wassern gewaschener weniger Politprofi, äußerst erfahren darin, „das System zu seinen Gunsten zu manipulieren“ ,(„Eine Regierung ganz ohne Korruption? Ein guter Witz.“ ), zieht Carlos trotz dessen anfänglicher Bedenken immer mehr in seinen Wirkungskreis. Das geht soweit, dass Carlos 1965 die politische Seite wechselt und sich Ferdinand Marcos anschließt.
Er bleibt dabei, auch als Damian an seiner Seite erschossen wird. Er will beim Aufbau der „Neuen Gesellschaft“ mitwirken. Damals kam es ihm aber noch „nicht in den Sinn, dass jeder Mensch, seien seine Absichten auch noch so edel, Maß und Mittel verliert, sobald er sich den Göttern ebenbürtig wähnt: allwissend, unantastbar, ewig“. Aber selbst nach Verhängung des Kriegsrechts und dem Beginn der Militärdiktatur bleibt er Marcos treu und findet auch dafür eine späte Rechtfertigung: „Gewehre, Gewalttäter und Gold – unsere einzige Wahl bestand zwischen den Rebellen in den Bergen und den Banditen im Kongress“. Und: „Es gab zu wenig Reiche und zu viele Arme. Es gab Menschen, die das Land beackerten, das ihnen nicht gehörte. Es gab Kriminalität und Warlords und Gauner in Anzügen. Und es gab die kommunistischen Rebellen“.
Die Fratze dieser „Neuen Gesellschaft“ : „70.000 Inhaftierte und 34.000 Gefolterte; über 3.200 außergerichtlich Getötete über einen Zeitraum von neun Jahren, von 1972-1981“ führt offensichtlich auch nicht zu einem späten Umdenken. Nicht zu reden von der jahrelangen Ausplünderung der Philippinen durch den Marcos-Clan.
Die Frage der Kollaboration wird in verschiedenen Facetten aufgegriffen, nicht nur aus der aktuellen Geschichte, sondern auch aus längst vergangenen Zeiten von Männern „die die ersten waren, die Spanisch gelernt haben und zwischen Kolonisierten und Kolonisatoren vermittelten. Kaum waren sie Christen, haben sie ihren Schülern beigebracht, die eigenen Eltern als Wilde zu betrachten“.
Bis hin zu der Frage, ob ein Lehrer berechtigt ist, über den Geschichtsunterricht einen Jungen an die düstere Vergangenheit seines Großvaters heranzuführen.
So vielfältig Formen der Kollaboration sind, so unterschiedlich wird auch damit umgegangen. Der Roman zeigt deutlich die Grenzen der Aufklärung, der (Selbst)Erkenntnis, des Wissenwollens oder Erklärenkönnens. So hat Renata eine ausgeprägte Kapazität der Verdrängung. Die Aufrechterhaltung der Familienfassade hat Priorität.
Zur Komplexität von Kollaboration gehört auch die Frage, wie die nachfolgende Generation damit umgeht. Die Familiengespenster werden vielfach zur Bürde der Kinder und Enkel. Nichtwissen, Ahnen, Verdrängen, Unverständnis, die Scheu, nachzufragen, Nicht-Verletzen-Wollen…die Bandbreite der Verhaltensfacetten ist groß.
Jacob, der Sohn Damians und Geschichtslehrer, erhält von seiner Frau Abbie den Vorwurf: „Du erinnerst zu viel“…„Menschen werden immer vereinnahmt, aus welchen Gründen auch immer. Und sie werden immer unter uns sein…Genau wie die Armen, wenn man dem Sohn Gottes Glauben schenken darf“.
Für Brynn, die Kontrastfigur zum Umfeld ihres Vaters, wird dessen Verhältnis zu Marcos zur unüberwindbaren Mauer. Marcos wurde durch die EDSA-Revolution 1986 ins Exil getrieben, starb 1989 auf Hawaii. Seine sterblichen Überreste konnten erst nach vielen Debatten 1993 auf die Philippinen zurückkehren, wo ihn seine Frau Imelda einbalsamiert in einem Glassarg der Öffentlichkeit zugänglich machte. Erst nach vielen Auseinandersetzungen und aufgrund eines Gerichtsurteils konnte sie Marcos dann 2016 auf dem „National Heroes Cemetery“ in Manila beisetzen.
Die emotional-tränenreiche Reaktion ihres Vaters vor dem Glassarg hatte für sie eine klare Konsequenz: „Also nein, ich frage ihn nicht warum. Ich weiß nur, dass er voll und ganz an den Mann geglaubt hat. Manchmal finde ich es fast beneidenswert, solch ein Urvertrauen zu haben, so eine Hingabe. Als wäre es seine Religion gewesen – und wie treibt man jemandem seine Religion aus?“
Es ist ein anspruchsvolles Buch. Verschiedene Themen verschränken sich,
Lebenswege trennen und kreuzen sich wieder, nach Jahrzehnten werden alte Rechnungen beglichen.
Der Roman gibt Einblicke in die großen Linien philippinischer Geschichte mit besonderem Schwerpunkt auf das 20. Jahrhundert. Er thematisiert aber auch die Schattenseiten des politischen Systems. Die tief verwurzelten Korruptionsstrukturen spielen in nahezu jedem philippinischen Roman eine Rolle. Und obwohl die Philippinen keinerlei monarchische Traditionen haben, so wird auch hier „politische Macht vererbt“.
Die Hoffnungslosigkeit und Resignation, die viele Filipinos angesichts der Strukturen des politischen Systems befällt bringt die sterbende Renata mit ihren letzten Worten auf den Punkt: „Na, endlich mal was Neues“.
Auch die Frage nach Heimat und Identität wird, eingebunden in die deutsche Kolonialgeschichte in Gestalt des 13-jährigen Hans gestreift, der nach dem gewaltsamen Tod seiner Eltern in China auf die Philippinen kommt, aber auch dort als Laowei, als Nicht-Asiat, als Fremder den Rest seines Lebens verbringt und bis zur Existenzfrage in die Fronten der Kollaborationsdebatten gerät.
Der Roman ist nicht chronologisch aufgebaut. Manchmal werden nach meinem Geschmack etwas zu abrupt die jeweilige Perspektive und Zeit gewechselt. Diese Zeitsprünge, ja „Zeitwirbel“sind nicht immer sofort einzuordnen. Hinzu kommt, dass ohne historisches Vorwissen das Buch nicht leicht zu verstehen ist. Das kontextualisierende Nachwort von Annette Hug erleichtert das Verständnis der historischen Abläufe, aber ergänzende Eigenrecherche ist ratsam.
Danke an den @wagenbach_verlag für das Rezensionsexemplar.
Die Kollaborateure. @wagenbach_verlag
**
Collaborators, or “Quislings,” are not a specifically Filipino phenomenon. They have existed throughout history and in all parts of the world.
The centuries-long history of colonization in the Philippines (a Spanish colony since 1565, under US control after a brief period of independence in 1898, occupied by the Japanese during World War II between 1942 and 1945, and only gaining independence in 1946) offers a diverse panorama for the development of the most varied forms and manifestations of collaboration.
Where does complicity end and betrayal begin? What is necessary adaptation for survival, and where does career-conscious, opportunistic collaboration begin? And: “How do you hold accountable the propagandists, the whisperers, the wrongdoers, all those who simply looked away?”
Tuvera addresses this exciting and complex topic in her first novel published in German.
It begins with the turbulent phase of President Estrada’s impeachment due to a corruption scandal at the turn of the millennium. While the conflicts rage in the streets and in parliament, Carlos Armando is in his final days, which does not prevent his wife and daughter from acting out their mutual incomprehension.
Carlos remembers his childhood, his school days during the Japanese occupation and the persecution of collaborators, his early days with Renata, his wife, but above all his political career, which began in the 1960s. However, his self-criticism is limited to the too little time he spent with his daughter Brynn. Otherwise, he finds an explanation, a justification for everything, if he questions anything at all.
His closest friend Damian, a seasoned political professional who is extremely skilled at “manipulating the system to his advantage” (“A government without corruption? That’s a good joke.”), draws Carlos more and more into his sphere of influence, despite Carlos‘ initial reservations. This goes so far that in 1965 Carlos changes sides politically and joins Ferdinand Marcos.
He sticks to his guns, even when Damian is shot dead at his side. He wants to help build the “New Society.” At the time, however, it “did not occur to him that every human being, no matter how noble their intentions, loses all sense of proportion and restraint as soon as they imagine themselves to be equal to the gods: omniscient, untouchable, eternal.” But even after martial law was imposed and the military dictatorship began, he remained loyal to Marcos and found a belated justification for this: “Guns, violent criminals, and gold—our only choice was between the rebels in the mountains and the bandits in Congress.” And: “There were too few rich and too many poor. There were people who worked the land that did not belong to them. There was crime and warlords and crooks in suits. And there were the communist rebels.”
The grim face of this “New Society”: “70,000 prisoners and 34,000 tortured; over 3,200 extrajudicial killings over a period of nine years, from 1972 to 1981” obviously does not lead to a belated rethinking either. Not to mention the years of plundering of the Philippines by the Marcos clan.
The issue of collaboration is addressed in various facets, not only from current history, but also from times long past, when men “were the first to learn Spanish and mediated between the colonized and the colonizers. No sooner had they become Christians than they taught their students to regard their own parents as savages.”
This leads to the question of whether a teacher is justified in using history lessons to introduce a boy to his grandfather’s dark past.
As diverse as the forms of collaboration are, so too are the ways in which they are dealt with. The novel clearly shows the limits of enlightenment, (self-)awareness, the desire for knowledge, and the ability to explain. Renata, for example, has a pronounced capacity for repression. Maintaining the family façade is her priority.
The complexity of collaboration also includes the question of how the next generation deals with it. The family ghosts often become a burden for the children and grandchildren. Ignorance, ancestors, repression, incomprehension, the reluctance to ask questions, the desire not to hurt anyone… the range of behavioral facets is wide.
Jacob, Damian’s son and history teacher, is accused by his wife Abbie: “You remember too much”… “People are always being taken advantage of, for whatever reason. And they will always be among us… Just like the poor, if you believe in the Son of God.”
For Brynn, who contrasts sharply with her father’s circle, his relationship with Marcos becomes an insurmountable wall. Marcos was forced into exile by the EDSA Revolution in 1986 and died in Hawaii in 1989. After much debate, his remains were finally allowed to return to the Philippines in 1993, where his wife Imelda had him embalmed and placed in a glass coffin for public viewing. Only after many disputes and a court ruling was she finally able to bury Marcos in 2016 at the National Heroes Cemetery in Manila.
Her father’s emotional, tearful reaction in front of the glass coffin had a clear consequence for her: “So no, I don’t ask him why. I just know that he believed in the man wholeheartedly. Sometimes I find it almost enviable to have such basic trust, such devotion. It was as if it were his religion – and how do you drive someone’s religion out of them?”
It is a challenging book. Various themes intertwine, lives separate and cross paths again, and after decades, old scores are settled.
The novel provides insights into the broad outlines of Philippine history, with a particular focus on the 20th century. However, it also addresses the dark side of the political system. Deeply rooted structures of corruption play a role in almost every Philippine novel. And although the Philippines has no monarchical traditions whatsoever, “political power is inherited” here too.
The hopelessness and resignation that afflicts many Filipinos in view of the structures of the political system is summed up by the dying Renata in her last words: “Well, finally something new.”
The question of home and identity is also touched upon, embedded in German colonial history in the form of 13-year-old Hans, who comes to the Philippines after the violent death of his parents in China, but also spends the rest of his life there as a Laowei, a non-Asian, a stranger, and ends up on the front lines of the collaboration debates, questioning his very existence.
The novel is not structured chronologically. Sometimes, to my taste, the perspective and time change a little too abruptly. These leaps in time, or rather “time swirls,” are not always easy to place immediately. In addition, the book is not easy to understand without prior historical knowledge. Annette Hug’s contextualizing afterword facilitates understanding of the historical events, but supplementary research on one’s own is advisable.
Ateneo de Manila University Press @ateneopress